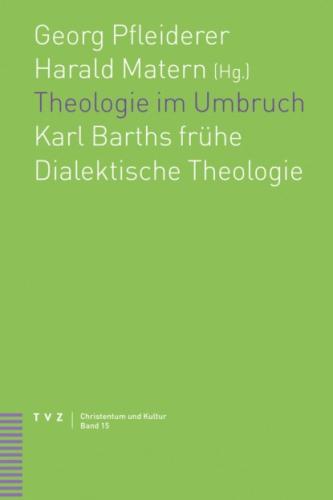In Barths an sich sehr knappen Notizen, die den genau aufgeführten Gesetzesparagrafen folgten oder beigefügt waren, fällt auf, dass er einerseits die Verkürzung der Arbeitszeit unzureichend fand, zumal sie nur auf ein Niveau gesenkt wurde, das – wie er notierte – in 65 Prozent der Betriebe |57| bereits eingeführt war120. Mehr Freizeit sei infolge der immer anstrengender werdenden Fabrikarbeit nötig. Mit «freie Zeit wird nicht versoffen»121 reagiert Barth offensichtlich auf entsprechende gegnerische Argumente. Auch frühere Zeitverkürzungen seien nur unter Protest der Fabrikanten zustande gekommen (1914/15), obwohl die Arbeitsleistung durch eine Verkürzung grösser werde und die «grösste Unfallgefahr in den letzten zwei Stunden» zu verzeichnen sei.122
Was den Frauenschutz angeht, so gehörte Barth zu den vehementen Befürwortern. Seine Argumente, die er stichwortartig aufführte: die «schwächere Konstitution», Verdienst der Frauen sei meist nur Zuverdienst, geringe Organisationsfähigkeit.123 «Gründe dagegen seitens der Frauenrechtlerinnen nicht stichhaltig», schreibt er.124 Hier bezieht er sich wohl darauf, dass insbesondere ausländische Frauenbewegungen gegen Sonderbestimmungen für Frauen opponiert hatten. Sie erkannten die Ambivalenz dieses Frauenschutzes, der zwar das Los der doppelt und dreifach belasteten Fabrikarbeiterin erleichterte, die keineswegs nur Zuverdienerin war. Gleichzeitig machte er aber Frauen als Arbeitnehmerkategorie minderwertig, hielt sie zum Teil von besser bezahlten Arbeiten fern und legitimierte niedrigere Frauenlöhne. Nur ein Beispiel: Das Nachtarbeitsverbot des ersten Fabrikgesetzes, das für Männer in den Revisionen nach und nach durch Ausnahmeregelungen aufgeweicht wurde, galt für Frauen weiterhin absolut. Sie verloren daher in der Druckerei und Setzerei, in der sie bisher verhältnismässig gut bezahlte, qualifizierte Arbeiten verrichtet hatten, ihre Arbeit. Zudem war dieses Verbot ein Vorwand für die Gewerkschaften, die Ausbildung von Setzerinnen überhaupt zu unterbinden.125
Barth forderte zudem lapidar «bessere Männerlöhne». Damit übernahm er hier die Vorstellungen der Gewerkschaften, die sich über die Forderung des Familienlohnes des Mannes für die Besserstellung der Arbeiterschaft einsetzten. Dass viele Frauen – und Fabrikarbeit war auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Schweiz zu einem beträchtlichen Teil Frauenarbeit – |58| nicht «Zuverdienerinnen» waren, sondern als Ledige sich selbst unterhielten und die Herkunftsfamilie unterstützten bzw. als Witwen oder Geschiedene ebenfalls nicht vom Familienlohn eines Mannes profitieren konnten, blieb unberücksichtigt. Das Konzept der Zuverdienerin und die Vorstellung, dass es für die Familien besser wäre, wenn die Frauen nicht erwerbstätig wären, verhinderten weitgehend, dass die Gewerkschaften sich für eine Verbesserung der Frauenlöhne stark machten. Zudem führten sie dazu, dass Frauenarbeit «versteckt» wurde, war sie doch der Beweis, dass es ein Mann nicht «geschafft» hatte, wenn die Familie auf den Verdienst der Frau angewiesen war.126
Hier trafen sich aber die bürgerlichen Vorstellungen, die das Haus als Wirkungsstätte der Frau sahen, und die der Gewerkschaften, auf deren Seite Barth in dieser Frage stand. Er hätte auch gern noch den Schutz der jungen Frauen verstärkt – er befürwortete einen Arbeitsbeginn der Mädchen als «Mütter der Zukunft» mit 15 statt mit 14, wie für die Knaben; «das non possumus der Arbeitnehmer ist nicht so ernst zu nehmen»127. Abschliessend bezeichnete Barth das Gesetz als «unter Achselzucken annehmbar», eine weitere Verbesserung müsste durch den Ausbau der gewerkschaftlichen Organisation «zur weiteren Selbsthilfe» erfolgen.128
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden jedoch nicht nur die Verbesserungen der Arbeitssituation sistiert, also die Inkraftsetzung des Gesetzes ausgesetzt, sondern insgesamt auch das bisher geltende Fabrikgesetz ausser Kraft gesetzt. Hier begann eine Entwicklung, die die städtischen Arbeitskräfte belastete, die zudem durch steigende Mieten, die schlechte Versorgungslage und die steigenden Lebensmittelpreise stärker betroffen waren als die Landbevölkerung, insbesondere als die Bauern. Zudem war offensichtlich, dass es neben den Verlierern diejenigen gab, die aus dieser Situation enorme finanzielle Gewinne zogen, sei es in der Rüstungsindustrie oder durch Erhöhung von Lebensmittelpreisen. Der Antagonismus Stadt – Land wurde dadurch akzentuiert. |59|
3. Der Landesstreik 1918
Es waren diese Spannungen, die sich schliesslich im Landestreik entluden.129 Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg hatten auch Sozialdemokraten zusammen mit den bürgerlichen Parteien im sogennanten Burgfrieden die militärischen Massnahmen zur Verteidigung der Schweiz gutgeheissen und für die Dauer des Krieges auf politische und gewerkschaftliche Kampfmassnahmen verzichtet. Barth hatte schon zu Beginn des Krieges in seinen Vorträgen130 das «Versagen»131 von Christen und Sozialisten angeprangert, weil sie den Krieg nicht verhindert hatten. Dass nun das Nationale, also ein «nationaler Sozialismus» und ein «nationales Christentum»132 im Vordergrund stünden, habe Christentum wie Sozialismus pervertiert.
Es gelang der Schweiz, sich aus den Kriegshandlungen herauszuhalten. Das rohstoffarme, hochindustrialisierte Land war allerdings wirtschaftlich durch den Krieg stark betroffen. Bei Ausbruch des Krieges hatte der Bundesrat die Generalmobilmachung der Armee beschlossen und damit die ökonomische Situation der Arbeiterbevölkerung verschlechtert. Durch Verhandlungen mit beiden kriegführenden Parteien hatte man nur eine minimale Versorgung mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln sicherzustellen versucht. Trotzdem wurde keine Lebensmittelrationierung beschlossen. Eine Lohnausfallentschädigung während des Militärdienstes gab es nicht. Lohnkürzungen, unentschädigte Überstunden, Sonntags- und Nachtarbeit waren die Folge der Aussetzung des Fabrikgesetzes.
Der Graben zwischen Deutschschweiz und Westschweiz verstärkte sich, weil man in der Westschweiz die Deutschfreundlichkeit der Deutschschweizer fürchtete. Barth weist an anderer Stelle verschiedentlich auf diese Gefahr hin, betont die Wichtigkeit der Neutralität auch für den inneren Zusammenhalt der Schweiz.133 |60|
Der Militärdienst – das Warten an der Grenze, aber auch der Drill der Offiziere, die deutsches Militär zum Vorbild genommen hatten, als Schikanen wahrgenommen – drückte auf die Moral, der Ersatz der Männer durch Frauen in der Industrie ging nochmals zulasten der Familien. 1917 wurde der Burgfrieden von den Sozialdemokraten faktisch aufgekündigt. Die sozialen Probleme stärkten die Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Parteien, deren Mitgliederzahlen stiegen. Seit November 1917 entluden sich die Spannungen in Form von gewaltsamen Unruhen, Streiks und Demonstrationen.
Der Landesstreik vom November 1918 gilt als Höhepunkt der politischen Konfrontation zwischen dem «Bürgerblock», den traditionellen liberalen und konservativen Kräften, und der Arbeiterbewegung. Im Juli 1918 hatte der Schweizerische Arbeiterkongress dem sogennanten Oltener Komitee die Vollmacht erteilt, einen Generalstreik auszurufen.
1918 wurden dem Bundesrat folgende konkrete politische Forderungen gestellt:
Neuwahl des Nationalrates nach dem Proporzsystem
Frauenstimmrecht
Einführung einer Arbeitspflicht
Beschränkung der Wochenarbeitszeit (48-Stunden-Woche)
Reorganisation der Armee zu einem Volksheer
Ausbau der Lebensmittelversorgung
Alters- und Invalidenversicherung
Verstaatlichung von Import und Export
Tilgung der Staatsschulden durch die Besitzenden
Staatsmonopole für Import und Export
Der Bundesrat reagierte auf diese Forderungen mit militärischen Drohungen. Das Aktionskomitee rief am 7. November 1918 zu einem Proteststreik auf, der am Samstag, 9. November, in 19 Industriezentren ruhig verlief. Die Arbeiterunion in Zürich setzte den Streik fort, der Bundesrat bot Militär auf, es kam am 10. November zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Militär, worauf das Oltener Aktionskomitee für den 12. November zu einem unbefristeten, landesweiten Generalstreik aufrief.
Am