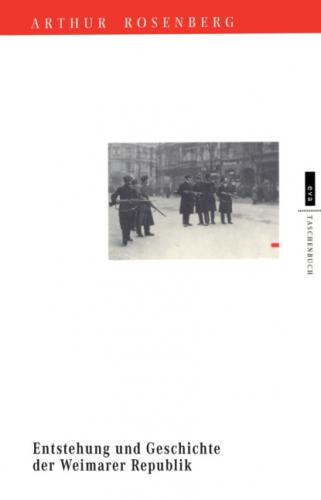Zur Zeit der Reichsgründung verfügte das liberale Bürgertum in Deutschland über fast alles, was an Intelligenz, an industrieller und kaufmännischer Leistungsfähigkeit vorhanden war. Die Massen der Handwerker und des übrigen Mittelstandes, der größte Teil der Industriearbeiter, selbst ein erheblicher Teil des Bauerntums und eine Minderheit des Adels, teilten die nationalen und liberalen Ideen des Bürgertums und folgten seinen politischen Parolen: Ohne Zweifel eine gewaltige Kraft und Autorität2. Auf der anderen Seite stand das preußische Heer, der König, sein Offizierskorps, die preußische Beamtenhierarchie, der Großgrundbesitz der Gebiete östlich der Elbe, bis auf die Gruppe der liberalen Aristokraten, und der vom Grundherrn abhängige Teil der Landbevölkerung. Wie sollte ein Kompromiß zwischen diesen beiden Kräften aussehen?
In Preußen hatte der König und mit ihm die militärische Aristokratie alle Gewalt. Die militärische Disziplin hatte in dem Menschenalter vor 1871 die schwersten Belastungsproben überstanden. Weder die Revolution von 1848 noch die Konfliktszeit der sechziger Jahre hatte das Gefüge des preußischen Heeres ernstlich erschüttert. Der König ernannte die preußischen Minister nach freiem Ermessen. Der Beamten- und Polizeiapparat war fest in der Hand der Regierung. Wenn ein oppositioneller Landtag den Staatshaushalt nicht bewilligte, regierte der König ohne gesetzlich zustande gekommenen Etat weiter. Das hatte die Konfliktszeit ebenfalls bewiesen. Ein Volksaufstand gegen das intakte preußische Heer war aussichtslos. Auch der oppositionell gestimmte Rekrut fügte sich der Disziplin, und das eiserne System des preußischen Offiziers- und Unteroffizierskorps zeigte keine Lücke. Wenn auch hier und da im Lande ein liberaler Richter saß, stand doch die Staatsmaschine vom Oberpräsidenten bis herunter zum letzten Gendarmen unbedingt der Regierung zur Verfügung.
Das altkonservative Preußentum hatte also sämtliche politischen Trümpfe in der Hand. Ein Kompromiß war nur so denkbar, daß die militärische Aristokratie freiwillig einen erheblichen Teil ihrer Rechte an das Bürgertum abtrat. Das konnte auf doppelte Art geschehen: Entweder erhielt das Bürgertum einen Anteil an der realen Staatsmacht in Preußen selbst, oder man beteiligte das Bürgertum an der Macht im Reich und übertrug zugleich auf das Reich so weite Kompetenzen, daß damit das alte Preußentum ein Gegengewicht fand. Keinen der beiden Wege ist Bismarck bei der Reichsgründung gegangen; er ließ in Preußen das tatsächliche Kräfteverhältnis so, wie es war. Das heißt, der König und die militärische Aristokratie behielten alles in der Hand, und ferner schuf Bismarck eine Verfassungskonstruktion, bei der Preußen das Reich regierte und nicht umgekehrt.
Es wäre ganz falsch, die Handlungsweise Bismarcks aus borniertem Kastenhochmut zu erklären. Bismarck hat den preußischen »Junker« keineswegs besonders geliebt, und er hat die Bedeutung des Bürgertums niemals verkannt. Aber er sagte sich, daß das Deutsche Reich bei seiner besonders schwierigen außenpolitischen Situation ohne starke Militärgewalt nicht leben könne. Eine leistungsfähige deutsche Armee, die nötigenfalls im Osten und im Westen ‹lie Abwehr führen konnte, sei aber nur durch Preußen zu bilden. Eine Zertrümmerung des preußischen Militärsystems sei zugleich die Wehrlosmachung Deutschlands, und wenn Deutschland seine staatliche Existenz nicht verteidigen könne, sei damit auch der innenpolitische Streit gegenstandslos. So war Bismarck ein überzeugter Anhänger des alten preußischen Militärsystems. Er vertrat die militärische Herrschaft des preußischen Königs über Deutschland und die unbedingte Kommandogewalt des Königs über die Armee, frei von jedem parlamentarischen Einfluß.
Wenn aber das alte Preußentum die Waffen Deutschlands führte, war es sehr schwer, ihm politische Zugeständnisse an die anderen waffenlosen Volksschichten abzuzwingen. Auch wenn Bismarck gewollt hätte, wäre es ihm kaum gelungen, den König Wilhelm I. zum Verzicht auf wesentliche Teile seiner Rechte zu nötigen. Es war ein Verhängnis für die ganze folgende deutsche Entwicklung, daß die Konfliktszeit in Preußen mit einem so restlosen Siege der königlichen Gewalt geendigt hatte. Das alte Preußentum hatte den Ansturm des bürgerlichen Liberalismus auf der ganzen Linie abgeschlagen. Der König von Preußen und sein Heer hatten 1864 gesiegt, ebenso 1866 und 1870/71; nur so war das Deutsche Reich möglich geworden. Und nach solchen Erfolgen sollte der König auf seine Rechte zugunsten des Parlamentarismus verzichten? So ließ Bismarck das alte Preußen, wie es war, und gab ihm überdies die Führung in Deutschland.
Das Geheimnis der Bismarckschen Reichsverfassung liegt darin, daß eigentlich keine Reichsregierung gebildet wurde. An Stelle der Reichsregierung stand der Bundesrat, die Gemeinschaft der einzelstaatlichen Regierungen, mit dem Reichskanzler als ihrem geschäftsführenden Vertrauensmann. Daß das buntscheckige Gesandtenkollegium des Bundesrats in Wirklichkeit gar nicht regieren konnte, das muß Bismarck von Anfang an gewußt haben. So war der Bundesrat das konstitutionelle Feigenblatt für die preußische Regierung über das Reich, und der Reichskanzler in Personalunion mit dem preußischen Ministerpräsidenten machte die deutsche Politik. Wenn in einer Spezialfrage zum Beispiel Bayern Sonderwünsche hatte, mußte die Frage auf diplomatischem Wege zur Erledigung gebracht werden, aber niemals ist die Reichspolitik durch das Zusammenwirken von Bayern und Baden mit Hamburg, Waldeck usw. bestimmt worden. Das Hauptstück der Reichsverfassung Bismarcks, die Reichsregierung durch den Bundesrat, war also von Anfang an eine offenkundige Fiktion.
Der Reichstag konnte zwar über alle politischen Fragen öffentlich reden. Aber die Armee und die Außenpolitik waren von vornherein seinem Einfluß entzogen. Das Geldbewilligungsrecht des Parlaments für das Heer durfte unter keinen Umständen die kaiserliche Kommandogewalt beeinträchtigen, und die Außenpolitik machte der Kaiser, beziehungsweise der Reichskanzler, ohne sich um die Reichstagsreden zu kümmern. Die innerpolitische Wirksamkeit des Reichstags wurde zunächst durch die Sonderrechte der Einzelstaaten lahmgelegt, und vor allem durch die vollständige Einflußlosigkeit des Reichsparlaments auf die Exekutive. Der Reichstag konnte höchstens den Etat ablehnen. Aber der böse Präzedenzfall der preußischen Konfliktszeit bewies, daß dann die Regierung ihre Zahlungen ohne gesetzliche Deckung weiter leistete. So war die einzige Waffe des Parlaments von vornherein stumpf.
Weder durch Ausnutzung des preußischen Landtags noch mit Hilfe des Reichstags war das Bürgertum in der Lage, einen maßgebenden Einfluß auf die deutsche Politik auszuüben. Aber Bismarck wußte trotzdem ganz genau, daß das Deutsche Reich ohne und gegen das Bürgertum weder zu gründen noch zu behaupten war. Verfassungsmäßige Rechte auf Kosten der Krone sollte das Bürgertum nicht erhalten. Aber der Regent, formal der Kaiser, in Wirklichkeit der Reichskanzler, sollte dafür sorgen, daß die berechtigten Ansprüche des liberalen Bürgertums erfüllt wurden: Die nationale Ausgestaltung des Deutschen Reichs sollte die Ideen der bürgerlichen Patrioten verwirklichen, die wirtschaftlichen Wünsche von Handel und Industrie sollten erfüllt werden. Die Ansprüche der Liberalen auf eine moderne, geistig hochstehende, allem »Muckertum« abgeneigte Regierungsform sollten, soweit es irgend ging, befriedigt werden. Bismarck wollte sogar noch weiter gehen: Er war bereit, Vertrauensmännern des liberalen Bürgertums einzelne Ministerposten in Preußen und wichtige Verwaltungsstellen im Reich anzuvertrauen und mit den liberalen Parlamentsfraktionen sachlich zusammenzuarbeiten. Aber all dies sollte auf dem freien Willen des Kaisers, bzw. seines entscheidenden Ratgebers beruhen. Wenn es nötig war, wollte Bismarck sich und seinen Nachfolgern jederzeit die Möglichkeit vorbehalten, die Liberalen so zu schlagen wie in der Konfliktszeit.
Vom Bürgertum verlangte Bismarck, daß es mit derartigen Zugeständnissen sich zufrieden gab und die Besonderheiten der außenpolitischen und militärpolitischen Lage Deutschlands begriff. Die starke militärische Kaisergewalt war doch die beste Stütze für das besitzende Bürgertum gegen die Gefahr einer proletarischen sozialen Revolution. Die Pariser Kommune hatte auf Bismarck den stärksten