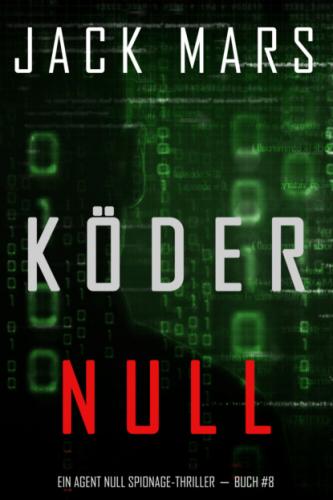„Ich bin allein hier.“
Er erschien in der Tür und grinste. „Na, in dem Fall: Hallo Liebes. Wo ist deine Schwester?“
„Kunstunterricht im Gemeindezentrum.“
„Stimmt. Ich hatte vergessen, dass sie dahingeht. Aber ich freue mich darüber. Soll ich sie abholen?“
„Ist mit dem Rad gefahren.“
Ihr Vater blinzelte unverständig. „Im Februar?“
„Sie sagte, dass sie die Kälte mag. Hält sie munter.“
„Sowas. Und mich nennt sie komisch.“
Maya rutschte vom Bett und folgte ihm in die Küche, wo er im Kühlschrank herumkramte und ein Light-Bier herauszog. Nachdem er den Kronkorken abgedreht hatte, fuhr er sich mit einer Hand durch sein Haar und seufzte, bevor er den ersten Schluck nahm.
„Du bist frustriert“, bemerkte Maya.
„Nö, mir geht’s gut. Glücklich und froh wie der Mops im Haferstroh.“ Er versuchte, es mit einem Grinsen abzutun, doch sie bemerkte es. „Es sollte eigentlich ,Glücklich und froh wie der Mops im Haferstroh, wenn es dort was Leckeres zu Fressen gibt‘ heißen. Weißt du eigentlich, woher das Sprichwort kommt? Einige meinen es stammt von…“
Er hielt inne, als sie ihre Arme verschränkte und eine Augenbraue hochzog. „Du bist frustriert. Oder irgendwas ärgert dich. Vielleicht auch beides. Du hast deine Schuhe nicht ausgezogen, als du hereinkamst. Du hast dir sofort ein Bier geholt, dir durch die Haare gefahren -“
„Das bedeutet doch gar nichts“, argumentierte er.
„Und jetzt versuchst du abzulenken“, beendete sie ihren Satz. „Ich könnte wetten, du schlägst gleich vor, dass wir heute Abend Pizza bestellen.“ Pizza war sein typisches Abendessen, wenn er zu viel im Kopf hatte.
„OK, du hast mich erwischt.“ Er fügte murmelnd hinzu: „Manchmal wünsche ich mir, ihr wärt dümmer oder nicht so aufmerksam.“
„Willst du mir erzählen, wie es dir bei den ,Besorgungen‘ erging?“ fragte Maya.
Er dachte einen Moment darüber nach und sagte dann: „Zieh dir eine Jacke an.“
Sie zog sich einen Mantel an und folgte ihm auf den kleinen Balkon hinaus. Er war kaum groß genug für die zwei Stühle und den kleinen Glastisch zwischen ihnen. Doch sie setzten sich nicht. Ihr Vater schloss die Glastür hinter ihnen und lehnte sich gegen das Geländer.
Maya knöpfte ihren Mantel zu und verschränkte die Arme, um sich gegen die eisige Winterluft zu wehren. „Raus damit.“
„Ich suche nach jemandem“, sagte er ihr und sprach so leise, dass nur sie ihn hören konnte. „Ein Agent oder jemand, der mal einer war, vor etwa fünf Jahren. Er heißt Connor.“
„Vor- oder Nachname?“ wollte Maya wissen.
Er zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Er könnte tot sein. Und wenn er es nicht ist, dann hat er sich sehr gut versteckt.“
Sie runzelte die Stirn, wunderte sich, warum ihr Vater nach einem vermutlich toten Agenten suchte. „Was brauchst du von ihm?“
Ihr Vater nahm einen langen Schluck aus der Flasche und murmelte dann etwas vor sich hin. Maya konnte es nicht ganz verstehen, aber es schien ihr fast als ob er „Papierkram“ gesagt hätte.
„Was?“
„Nichts“, sagte er ihr. „Ich kann dir das nicht sagen. Es hat was… mit der Arbeit zu tun.“
„Ich verstehe.“ Doch angesichts seines Verhaltens und der Tatsache, dass er nicht bei der CIA war, um eine großangelegte Suchaktion nach diesem Mann zu starten, vermutete sie, dass es sich ganz und gar nicht um Arbeit handelte. „Und warum erzählst du mir das hier draußen in der verdammten Kälte?“
Er antwortete nicht, sondern schoss ihr einen scharfen Blick zu. Sie brauchte einen Moment, um ihn zu verstehen, doch dann drehte sich ihr der Magen um.
„Oh Gott, du glaubst doch nicht wirklich…?“ Sie hielt sich davon zurück, es laut auszusprechen. Er dachte, ihre Wohnung könnte verwanzt sein.
„Ich bin mir nicht sicher. Alan hat sie ein paar Mal durchsucht, doch die werden immer kreativer.“
Maya schüttelte angewidert den Kopf bei dem Gedanken, dass alles was sie sagte, vielleicht sogar alles was sie tat - um schon gar nicht ihre kleine Schwester zu erwähnen - auf einer CIA-Datenbank irgendwo aufgezeichnet wurde. Man hatte ihr einmal einen Ortungschip unter die Haut eingepflanzt. Sie hatte es schon schlimm genug gefunden, dass damals ihr Aufenthaltsort jederzeit bekannt war.
Doch wirklich beobachtet zu werden… es rief ihr die Erinnerung an diese drei Teenager in West Point ins Gedächtnis. Sie hatten sich im Umkleideraum versteckt, hatten gewartet, bis sie aus der Dusche kam, um sie anzugreifen. Wer wusste, wie lange sie da gewesen waren, was sie gesehen hatten…?
Sie verdrängte den Gedanken. Ihr Vater wusste über den Vorfall nur in groben Zügen Bescheid und sie hatte keine Lust, jetzt noch einmal darüber zu sprechen. Das war ihr Problem und er hatte sein eigenes.
„Was hast du als nächstes vor?“ fragte sie.
Er winkte mit der Hand ab. „Es gibt da möglicherweise einen Doktor, der ihn kennt. Oder kannte. Ich weiß es noch nicht. Ich warte auf Informationen von Reidigger.“ Er lächelte sie über seine Schulter an. „Komm schon, lass uns wieder reingehen.“
„Warte mal. Wenn du darüber eigentlich nicht reden solltest, warum erzählst du mir das alles?“
Er starrte sie einen Moment lang an. Lang genug, um sie denken zu lassen, dass er sich auch nicht sicher war, warum.
„Wenn ich frustriert bin“, sagte er schließlich, „dann fühle ich mich weniger frustriert, wenn ich mit dir rede. Deshalb.“
Er klopfte ihr auf die Schulter und sie gingen wieder rein, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Sara die Eingangstür hinter sich schloss. Sie zog ihre Wollmütze aus, ihre Nase und Wangen waren gerötet und spröde von der Winterluft.
Sara blickte ihren Vater nur einmal an und nickte. „Pizza zum Abendessen, was?“
Er schlug sich die Hände über dem Kopf zusammen. „Bin ich wirklich so berechenbar?“
Maya grinste - doch dann bemerkte sie, dass irgendetwas nicht mit Sara stimmte. Sie bewegte sich steif, es schien mehr als nur die Kälte dahinterzustecken. Selbst nachdem sie sich ihren Parka ausgezogen hatte, schien ihre jüngere Schwester immer noch die Ellenbogen einzuziehen. Man könnte fast meinen, sie wollte sich verteidigen.
„Alles in Ordnung?“ fragte Maya.
Sara schniefte. „Ja. Ist nur… meine gewöhnliche Scheiße.“
„ Wie redest du denn?“ rief ihr Vater aus der Küche. Und dann: „Ja, zwei große Pizzas bitte…“
„Mir geht’s gut“, versicherte ihr Sara und ging auf ihr geteiltes Schlafzimmer zu.
Maya glaubte das nicht, doch sie wusste, dass sie Sara zu nichts zwingen konnte. Sie hatten alle ihre eigenen Probleme und sie kümmerten sich jeder auf seine Weise darum. Sie schienen allerdings eine ganze Menge Geheimnisse voreinander zu haben, obwohl sie doch eine Familie waren, die sich versprochen hatte, ehrlich miteinander zu sein. Aber es war keine Frage der Unehrlichkeit, es war eine Frage der Unabhängigkeit. Es ging darum, für sich selbst verantwortlich zu sein.
Allerdings fühlte sich das manchmal auch sehr einsam an.
Aber vielleicht muss es das gar nicht sein. Sie dachte über diesen vermissten Connor nach. Es musste doch einen Weg geben, diesen Typen zu finden… vielleicht könnte jemand, der so schlau war wie sie, das sogar herausfinden. Vielleicht gab es etwas, das sie für ihren Vater tun könnte. So könnte sie ihm zeigen, anstatt es ihm nur zu sagen, dass er nicht immer allein auf seinen Problemen sitzen musste.
Wenn sie nur lernen könnte, ihre eigenen Ratschläge anzunehmen.