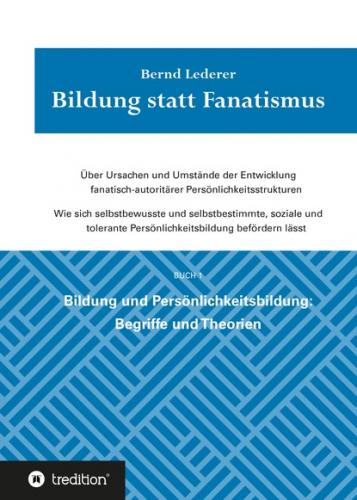Bestärkt wird durch dergleichen Entwicklungen und Umstände gesellschaftlicher Art eine grundlegende Persönlichkeits- und Verhaltensdisposition: Eben der besagte „autoritäre Sozialcharakter“ bzw. die „autoritäre Persönlichkeitsstruktur“ als Ergebnis einschlägiger Prägungen, wirkmächtiger Erziehungsziele und -methoden sowie sozioökonomischer wie soziokultureller Sozialisationserfahrungen. Eine umfassende und humane Bildung, die ja, wie zu zeigen, immer auch eine vernünftige, mündige und humane, emanzipierte Geistes- und Werthaltung umfasst, steht weitestgehend im Widerspruch hierzu. In diesem Buch wird der Frage nachgegangen, wie sich die eine Persönlichkeitsstruktur schwächen, die andere hingegen bestärken lässt.
I. Grundbegriffe zum Einstieg
Worin unterscheiden sich bzw. was bedeuten indes Begriffe wie „Prägung“, „Erziehung“, „Sozialisation“ und auch „Bildung“, die in diesen beiden Bänden eine entscheidende Rolle spielen werden, eigentlich genau? Umgangssprachlich werden diese Begriffe oft synonym gebraucht, dabei beziehen sie sich aber auf ganz unterschiedliche Aspekte der „Personwerdung“ („Personagenese“), der „Individuation“, also der „Ich-Werdung“, der Ausprägung einer eigenen Persönlichkeit und Identität. Hierzu zählt auch die „Enkulturation“, die Übernahme gesellschaftlicher Werte und Normen, das Hineinwachsen in die menschliche Gemeinschaft und das Geformt-werden durch diese. Es geht also um unterschiedliche Begriffe und Konzepte, welche die soziale und kulturelle „Menschwerdung“, letztlich, und durchaus auch im Wortsinn, die „Persönlichkeits-Bildung“ des Menschen thematisieren. Wilhelm von Humboldt (1767–1835) fasst unter Bildung nämlich im denkbar umfassendsten Sinne die Menschwerdung des Menschen. Zunächst gilt es daher, diese Begriffe kurz zu präzisieren und zu differenzieren, bevor später mit ihrer Hilfe der Frage nachgegangen werden soll, welcher günstigen Bedingungen es bedarf, um eine Persönlichkeitsbildung im Sinne gelingenden, humanen Mensch-Seins zu ermöglichen und zu befördern.
Nachfolgend werden also zunächst die pädagogisch relevantesten Begrifflichkeiten in aller Kürze vorgestellt, differenziert und zueinander in Bezug gesetzt. Dies ist erforderlich, um die Argumentation des Buches nachvollziehen zu können, folgt diese doch Schlüsselbegriffen pädagogischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Persönlichkeitstheorien, die umgangssprachlich zumeist verwechselt oder gleichgesetzt werden. Erst eine differenzierte Betrachtung dieser Begriffe erlaubt es, verschiedene Ursachen und Bedingungen für ge- oder misslingende Persönlichkeitsbildung auseinanderzuhalten und ihre jeweilige Bedeutung zu benennen.
1. 1. Prägung
Prägung meint umgangssprachlich zunächst einmal die Gesamtheit aller Umwelteinflüsse, die auf die physische und vor allem psychische Entwicklung eines Menschen einwirken und diese beeinflussen und verändern und in der Regel das ganze Leben über (nach)wirken. In diesem Sinne lässt sich etwa sagen: „Die jeweilige Person ist durch die Kultur ihrer Herkunft geprägt“ oder: „Ihre Religion hat sie sehr geprägt“ usw. Im engeren, nämlich pädagogischen und psychologischen Sinne, nochmals genauer im entwicklungspädagogischen und -psychologischen wie auch psychoanalytischen Sinne, meint Prägung aber die frühkindlichen (und teils schon vorgeburtlichen) Erfahrungen, die den einzelnen Menschen in seiner weiteren Entwicklung nachhaltig, also andauernd, formen. Es sind dies die tiefwirkenden Erfahrungen der ersten Lebenswochen, -monate und -jahre, die sich in allererster Linie aus Kind-Mutter und Kind-Eltern-Interaktionen speisen. Eng verbunden hiermit ist der Begriff der „Bindung“, der sich auf dieses enge Verhältnis zwischen Kleinkind und seinen primären Bezugspersonen bezieht, die von sehr engen und intensiven Emotionen und Bedürfnissen gekennzeichnet sind. In erster Linie wird hierbei die Mutter-Kind-Beziehung der ersten Lebenswochen und -monate thematisiert (siehe noch ausführlicher V1 und V.2).
2. Erziehung
„Unter Erziehung versteht man die pädagogische Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Resultat dieser Einflussnahme.”2 Im Gegensatz zur Prägung ist die Erziehung ein bewussterer Akt seitens der Eltern oder anderer primärer oder aber auch sekundärer Bezugspersonen des Kindes und jungen Jugendlichen. Prozesse der Erziehung schließen sich entwicklungsgeschichtlich an die Phase der Prägung an bzw. laufen parallel zu dieser. Erziehung bezeichnet das wechselseitige Verhältnis zwischen einem Erzieher und einem zu Erziehenden (lateinisch gesprochen „Educans“ und „Educandus“). Die Absicht dieser Interaktion besteht darin, den zu Erziehenden als denjenigen, der bezüglich Lebenserfahrung, Kulturtechniken, sozial erwünschten Verhaltens an Erfahrung, Reife und Wissen ärmer ist, gemäß bestimmter Erziehungsziele auf das Niveau des Erziehers sozusagen heraufzuführen und ihn letztlich gewissermaßen in die Selbständigkeit zu entlassen. Maßnahmen der Erziehung beziehen sich somit in der Regel auf Kinder und Jugendliche. Pädagogik (griechisch: von „Paideia“: „Erziehung“, „Bildung“ oder „pais“: „Knabe“, „Kind“ und „agogein“: „führen“) ist deshalb mit Erziehungslehre nicht falsch übersetzt.3 Wichtig ist hier bereits der Hinweis, dass, im Rahmen der indoeuropäischen Sprachfamilie, nur in der deutschen Sprache zwischen Erziehung und Bildung unterschieden wird, wohingegen etwa im Englischen oder Französischen oder Spanischen beides unter „education“ firmiert. Bevor der Bildungsbegriff, der Fundamentalbegriff der Pädagogik neben Erziehung, noch eingehend zu erläutern sein wird, lassen sich hier bereits die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Begriffen anführen. In den Worten von Jochen Krautz: „Während ‚Bildung‘ eher die Selbstbildung, die selbständige innere Entwicklung betont, verweist ‚Erziehung‘ auf die notwendige Führung in einer Beziehung.“4 Helmwart Hierdeis wiederum bringt den Unterschied zwischen Erziehung und Bildung so auf den Punkt:
„‚Erziehung‘ meint (…) eher das, was im Umgang von Erwachsenen mit Kindern und Jugendlichen durch Anregen, Vormachen, Erklären, Hinwenden, Ermutigen, Einschränken, Gewöhnen, Schutz gewähren, Zuwendung und Schaffen einer förderlichen Umwelt geschieht und erreicht wird; ‚Bildung’ meint eher den Prozess und das Ergebnis der Auseinandersetzung des einzelnen mit der Welt und ihren Repräsentanzen in Sprache, Literatur,Wissenschaft, Kunst und Medien, die Verwandlung von Informationen in subjektiv bedeutsames Wissen.“5
Das Erziehen, so Hierdeis, habe mit Blick auf die Begriffsgeschichte von Erziehung immer auch mit Wünschen und Vorstellungen, mit Zielsetzungen und Handlungen zu tun, zudem mit einer spezifischen sozialen und materiellen Umwelt und Atmosphäre des Aufwachsens sowie, last but not least, natürlich mit bestimmten Beziehungen und Beziehungsmustern. Bildung, wie später noch ausgeführt wird, meint immer Selbstbildung und scheint zunächst weitaus weniger auf das soziale Miteinander, denn auf das eigene Selbst bezogen zu sein. Sie wirkt nach solchem Verständnis etwas freier von den sie bedingenden Umständen, setze sie doch „die Fähigkeit zur Weltaneignung, also das, was ‚Erziehung‘ zu leisten hat, irgendwie voraus.“6 Ungeachtet solcher qualitativen begriffsgeschichtlichen und -theoretischen Differenzierungen bleibt hier die deutschsprachige Besonderheit festzuhalten: Bei einer verengten Sichtweise des Bildungsbegriffs scheinen weite Bereiche des Pädagogischen ausgespart zu bleiben. Das betrifft vor allem entwicklungspädagogische und pädagogisch-psychologische Fragen der Kleinkinderziehung, etwa der frühkindlichen Identitätsbildung, der Grundlegung von Urvertrauen (u. a.), von Sicherheit und stabilen Bindungserfahrungen, der Vermittlung basaler Welt- und Wertorientierung, um hier nur einige wenige Gesichtspunkte anzuführen. Gleichwohl soll und wird im Laufe der weiteren Ausführungen der hohe Wert und auch die Brauchbarkeit, ja Notwendigkeit eines umfassenden Verständnisses von „Bildung“ als Persönlichkeitsbildung näher belegt werden.
Erziehungsziele