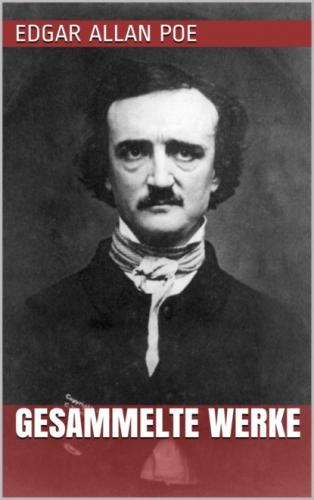Auf dem Tisch neben mir brannte eine Lampe, und daneben lag eine kleine Schachtel. Sie hätte durchaus nichts Auffallendes, und ich hatte sie schon manchmal gesehen, denn sie war Eigentum des Hausarztes; wie aber kam sie hier auf meinen Tisch, und warum schauderte ich, wenn ich sie ansah? Diese Fragen wollten sich in keiner Weise beantworten lassen. Meine Blicke fielen schließlich auf den unterstrichenen Satz eines offen vor mir liegenden Buches. Es waren die sonderbaren, doch einfachen Worte des Dichters Ebn Zaiat: »Dicebant mihi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.« – Warum nur standen mir die Haare zu Berge, als ich dies las, warum erstarrte mir das Blut in den Adern?
Es wurde leise an die Tür geklopft, und bleich wie der Tod trat ein Diener auf Zehenspitzen herein. Seine Blicke waren voll wahnsinnigen Entsetzens, und er sprach bebend zu mir mit gedämpfter, heiserer Stimme. Was sagte er? Einige abgerissene Sätze hörte ich. Er sprach von einem wilden Schrei, der das Schweigen der Nacht gebrochen habe – daß das Hausgesinde zusammengeströmt sei – daß man in der Richtung des Schreies auf Suche gegangen sei; und dann wurde seine Stimme unheimlich deutlich, als er von Grabschändung redete – von einem aus dem Sarg gerissenen, entstellten Körper, der noch atmete – noch pulste – noch lebte!
Er deutete auf meine Kleider; sie waren von Erde beschmutzt und mit Blut bespritzt. Ich sagte nichts, und er ergriff sanft meine Hand: sie trug frische Kratzwunden von Fingernägeln. Er lenkte meine Aufmerksamkeit auf einen an die Wand gelehnten Gegenstand: es war ein Spaten. Mit schrillem Aufschrei sprang ich an den Tisch und riß die Schachtel an mich, die dort lag. Aber es wollte mir nicht gelingen, sie zu öffnen. Und sie entglitt meinen zitternden Händen und schlug hart zu Boden und sprang in Stücke. Und heraus rollten klappernd zahnärztliche Instrumente und zweiunddreißig kleine, weiße, elfenbeinschimmernde Dinger und verstreuten sich rings auf den Fußboden ...
Bon-Bon
Quand un bon vin meuble mon estomac, Je suis plus savant que Balzac, Plus sage que Pibrac; Mon bras seul faisant l'attaque De la nation Cossaque, La mettroit au sac; De Charon je passerois le lac En dormant dans son bac; J'irois au fier Eac, Sans que mon cœur fit tic ni tac, Présenter du tabac.
Französisches Vaudeville.
Bon-Bon war ein Wirt von vielen Gaben. Keiner, der je im Cul-de-sac Lefebvre zu Rouen seine kleine Kneipe besuchte, wird es, glaube ich, bestreiten. Noch unbegreiflicher aber ist Pierre Bon-Bons Bewandertsein in der Philosophie seiner Zeit. Seine pâtés à la foie waren zweifellos von höchster Vortrefflichkeit; aber welche Feder könnte seinen Essays »Sur la Nature«, seinen Gedanken »sur l'Ame«, seinen Betrachtungen »sur l'Esprit« Gerechtigkeit widerfahren lassen! Wohl waren seine Omelettes und Frikandeaus unschätzbar, doch welcher damals lebende Schriftsteller hätte nicht doppelt soviel für eine »idée de bon-bon« gegeben als für den ganzen Ideenplunder aller übrigen »Weisen«? Bon-Bon hatte Bibliotheken durchstöbert, die noch niemand sonst durchforscht hatte, unwahrscheinlich viel gelesen und Dinge begriffen, deren Auffaßbarkeit jeder andere für ausgeschlossen gehalten hätte. Trotz alledem gab es selbst zu der Zeit, da er auf seiner Höhe war, Autoren in Rouen, die behaupteten,daß »seine Dikta weder die Klarheit der Akademiker noch die Tiefe der Lyzeisten« aufwiesen. Ich kann versichern, daß seine Lehren durchaus nicht allgemein verstanden wurden, obgleich daraus keineswegs gefolgert werden darf, daß sie schwer zu verstehen waren. Ich glaube, es war gerade ihre Selbstverständlichkeit, die sie vielen so verworren erscheinen ließ. Sagt es nicht weiter – aber selbst Kant verdankt im wesentlichen Bon-Bon seine metaphysischen Begriffe. Bon-Bon gehörte weder zur Schule Platos, noch, streng genommen, zu der des Aristoteles, noch verschwendete er, wie der neuzeitlichere Leibniz, kostbare Stunden, die der Erfindung eines Frikassees oder, in leichter Abstufung, der Analyse einer Empfindung gewidmet werden konnten, in leichtfertigen Versuchen, die unverträglichen Öle und Wasser einer Moraldisputation zu verbinden. Ganz und gar nicht. Bon-Bon war ionisch; Bon-Bon war aber auch italisch. Er überlegte a priori; er überlegte a posteriori. Seine Ideen waren angeborene oder erworbene. Er glaubte an Georg von Trapezunt, er glaubte an Bossarion. Bon-Bon war ganz überzeugt ein – Bonbonist.
Ich habe bereits davon gesprochen, wie hochbegabt der Philosoph als Wirt war. Es wäre aber falsch, wenn einer meiner Freunde mutmaßen wollte, daß der Held unserer Geschichte bei der Erfüllung seiner Standespflichten sich nicht vollständig ihrer Wichtigkeit und Würde bewußt gewesen wäre. Weit entfernt. Es war unmöglich zu sagen, auf welchen seiner »Berufe« er am meisten stolz war. Nach seiner Meinung waren die Geisteskräfte innig mit der Leistungsfähigkeit des Magens verbunden. Ich glaube, daß sich seine Auffassung fast mit der der Chinesen deckte, die der Meinung sind, der Aufenthaltsort der Seele seider Bauch. Auf alle Fälle gab er den Griechen recht, die für Geist und Zwerchfell das gleiche Wort gebrauchten. Natürlich fällt es mir nicht bei, durch diese Äußerung die Metaphysiker der Schlemmerei oder ähnlicher Untugenden anzuklagen. Wenn Peter Bon-Bon seine Fehler hatte – und welcher große Mann hätte nicht tausende? – also, wenn Bon-Bon seine Schwächen hatte, waren sie sehr geringfügiger Art – Fehler, die bei anderen Naturen oft eher als Tugenden angesehen werden. Was nun die eine dieser Schwächen betrifft, so würde ich sie überhaupt hier nicht erwähnen, wenn sie nicht so außerordentlich hervorstechend, so sehr in alto rilievo aus der Ebene seines sonstigen Wesens herausragend gewesen wäre. Nie konnte er sich die Gelegenheit entschlüpfen lassen, Geschäfte zu machen.
Nicht, daß er habgierig gewesen wäre – o nein! Zum Vergnügen des Philosophen war es durchaus nicht notwendig, daß der Handel zu seinem eigenen Vorteil ausfiel. Wenn nur ein Geschäft zustande kam – irgendein Handel irgendwelcher Art unter irgendwelchen Bedingungen –, so erstrahlte tagelang sein Antlitz in triumphierendem Lächeln, und ein schlaues Augenzwinkern war der Verkünder seiner Klugheit.
Ein solches Benehmen würde sicher zu jeder Zeit die Aufmerksamkeit und das Befremden der Umwelt herausgefordert haben. Überaus erstaunlich aber wäre es gewesen, wenn diese Eigenheit zur Zeit unserer Erzählung nicht ganzbesonders beachtet worden wäre. Bald lief ein Gerede herum, daß jedesmal dann das von Bon-Bon zur Schau getragene Lächeln sich grundsätzlich von dem Grinsen unterschied, wenn er seine eigenen Witze belachte oder einen akuten Bekannten begrüßte. Und aufregendeAnspielungen wurden gemacht, auf gefährliche Handelsgeschäfte die schnell abgeschlossen und später bereut worden seien; und Umstände wurden des weiteren angeführt, die irgendwie den Beweis führen sollten für unverständliches Können, für unbestimmte Wünsche und unnatürliche Neigungen, die vom Urheber alles Übels zur Erreichung seiner eigenen klugen Zwecke in Bon-Bon eingepflanzt worden seien.
Der Philosoph hat andere Schwächen, aber sie sind kaum einer Betrachtung wert. Zum Beispiel gibt es wenige Männer von außerordentlicher Tiefe, denen eine Neigung zur Flasche fehlt. Ob diese Neigung die Ursache oder der Beweis dieser Tiefe ist, ist schwer zu sagen. Soweit ich im Bilde bin, hat Bon-Bon es nicht für nötig gehalten, die Frage gründlich zu durchdenken; ich stimme mit ihm überein. Ich halte es nicht für ausgemacht, daß der Restaurateur bei seiner Nachgiebigkeit gegen eine so wirklich klassische Neigung das intuitive Unterscheidungsvermögen verlor, welches zugleich seine Essays und seine Omelettes auszeichnete. In den Standen seiner Einsamkeit hatte der Burgunder seine Zeit, und auch für die Côtes du Rhône hatte er seine bestimmten Stunden. Sauternes und Médoc verhielten sich für ihn zueinander wie Catull und Homer. Er konnte mit Syllogismen spielen, während er St. Peray schlürfte, bei Clos de Vougeot war er analytisch, und der Chambertin baute ihm seine Theorien. Es wäre gut gewesen, wenn Bon-Bon diese abwägende Genauigkeit auch auf vorbesagte Handelsneigung ausgedehnt hätte. Aber das