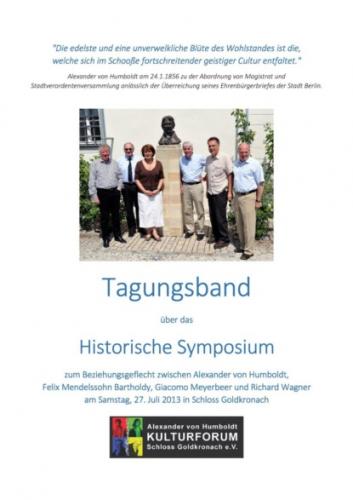Einen Text Wagners aber gibt es, der die Forderung nach musikhistorischer Konkretheit tatsächlich einlöst. Seine Bedeutung kann kaum übererschätzt werden, skizziert er doch unter der Überschrift „Über den Standpunkt der Musik Meyerbeers“ anhand von dessen Werken, vor allem der Huguenots, die aktuelle Situation der Oper und eröffnet zugleich eine Perspektive für die weitere Entwicklung der Gattung, die Wagner – unausgesprochen aber unmissverständlich – für sich selbst reklamiert. Der Text entstand während der Schlussphase von Wagners erstem Parisaufenthalt, also zu Beginn der 1840er Jahre, wohl für eine französische Zeitschrift, erschien aber erst nach Wagners Tod im Druck.[23] Seine opernhistorische Bedeutung kann kaum überschätzt werden. Darin heißt es: „Meyerbeer schrieb Weltgeschichte, Geschichte der Herzen und Empfindungen, er zerschlug die Schranken der Nationalvorurteile, vernichtete die beengenden Grenzen der Sprach-Idiome, er schrieb Thaten der Musik […].“[24] Die letzten Worte lassen aufhorchen, sprach doch Wagner 1872 in seinem Aufsatz „Über die Benennung ‚Musikdrama’“ von „ersichtlich gewordene[n] Thaten der Musik“,[25] nun freilich bezogen auf sein eigenes Werk. Der philosophisch-religiöse Aspekt der Meyerbeerschen Oper, ihr Ideenkontext, wird von Wagner klar herausgearbeitet: „Es ist auch nicht mehr nötig, große, gelehrte und ritualmäßige Messen und Oratorien zu schreiben, wir haben durch diesen Sohn Deutschlands erfahren, wie auch auf der Bühne Religion gepredigt werden kann […].“[26] Meyerbeer stellt er in einer Reihe mit Händel, Gluck und Mozart, mit denen er gemeinsam habe, erst durch die Überwindung nationaler Schranken in seine opernhistorische Rolle hineingewachsen zu sein. Mit Meyerbeer sei die letzte Periode der dramatischen Musik, die Rossini eingeleitet habe, zum Abschluss gelangt, und nun müsse „[…] die Zeit in ihrer rastlosen Schöpfungskraft eine neue Richtung hervorbringen […], in der dasselbe wieder zu leisten sein würde, was jene Heroen geleistet haben.“[27] An wen Wagner hier dachte, braucht nicht ausdrücklich gesagt zu werden. Wagner sieht sich also in der Tradition der großen Opernmeister nicht als nationalen, sondern als europäischen Künstler.
Wie reagierten Mendelssohn und Meyerbeer auf Wagners zunehmend gehässige Polemik? Mendelssohn starb zu früh (1847), als dass er sie noch hätte zur Kenntnis nehmen können. Meyerbeer hatte den „Judentum“-Essay in seiner Erstveröffentlichung gar nicht bemerkt; den Neudruck, der dann hohe Wellen schlug, hat er nicht mehr erlebt. Seit Anfang der 1850er Jahre konnte ihm aber nicht verborgen bleiben, dass Wagner von seinem bewundernden Anhänger zu seinem erbitterten Gegner mutiert war. Darauf reagierte er zwar enttäuscht, aber gelassen und behielt diese Haltung bis zu seinem Tode bei. Grund genug dazu hatte er: Seine Position im Musikleben als Großmeister der Oper blieb bis auf weiteres unangefochten, so sehr Wagner auch dagegen anrennen mochte. Auch dieser hatte inzwischen einen beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht, jedoch sahen die Zeitgenossen in ihm kaum mehr als einen begabten Avantgardisten, der durch seine operntheoretischen Schriften mehr Aufsehen erregte als durch seine Werke, die ihre Abhängigkeit von Meyerbeer – dies sahen die meisten sehr klar – nicht verleugnen konnten. Diese Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis war auch der tiefere Grund für das Debakel des Tannhäuser an der Pariser Opéra, nicht angebliche Intrigen, hinter denen gar – wie die Wagnerianer insinuierten – Meyerbeer persönlich gestanden haben solle. Diese Unterstellung ist eindeutig widerlegt durch einen Eintrag in Meyerbeers rein persönlich geführtem Tagebuch, in dem auf das Ereignis folgendermaßen Bezug genommen wird: „Heute trafen die Nachrichten von der 1. Vorstellung des Tannhäuser ein, der einen vollständigen Fiasco gemacht haben soll. Das Publikum soll viele Stellen förmlich (sowohl in Bezug der Musik wie des Textes) ausgelacht u. zuweilen gepfiffen haben. Die Fürstin Metternich und Gräfin Seebach, deren Protektion man die Aufführung des Werkes zuschreibt, wurden so höhnend vom Publikum betrachtet, daß sie nach dem 2. Akt das Theater verließen. Eine so ungewöhnliche Art des Mißfallens einem doch jedenfalls sehr beachtenswerten und talentvollen Werke gegenüber scheint mir ein Werk der Cabale und nicht des wirklichen Urteils zu sein […]“.[28] Tannhäuser kannte Meyerbeer damals bereits; um das Werk erstmalig zu hören, hatte er 1855 bei einer Reise eigens einen Umweg nach Hamburg nicht gescheut. Seine Eindrücke schilderte er so: „Die Oper selbst ist unstreitig eine höchst interessante musikalische Kunsterscheinung. Zwar ist großer Mangel an Melodie, Unklarheit, Formlosigkeit, aber doch sehr große Genieblitze in Auffassung, Orchesterkolorit und zuweilen sogar in rein musikalischer Hinsicht, namentlich in den Instrumentalsätzen“.[29] Ein Urteil, dass von Objektivität und Sachkenntnis zeugt; was Meyerbeer hier „Auffassung“ nennt, deckt sich mit dem heutigen Begriff „Konzeption“ und vor allem auf ihr – dies sieht die moderne Musiktheaterforschung nicht anders – beruht die musikhistorische Bedeutung des Werkes.
Und Humboldt? Mendelssohn und Meyerbeer, wie auch ihren Familien, blieb er bis zu seinem Tode aufs Herzlichste verbunden. Wagners Aufstieg hätte er während seiner letzten Lebensjahre noch verfolgen können, jedoch deutet nichts darauf hin, dass er ihn überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Für den an der Vollendung seines Kosmos arbeitenden Gelehrten blieben die neuesten musikalischen Entwicklungen, sofern sie nicht seine alten Freunde betrafen, außerhalb des Erfahrungshorizonts, und sollte er sie doch zur Kenntnis genommen haben, so ließen sie ihn jedenfalls unberührt. Was ihm wirklich wichtig war, offenbart sein Kondolenzbrief an Meyerbeer aus Anlass des Todes von dessen geliebter Mutter Amalie, der auch er zeitlebens in liebender Verehrung zugetan gewesen war: „Mein theurer, innigst verehrter Freund! […] Auch ein lange drohendes Unglück ist, wenn es ein so mächtiges ist, in seiner tiefen Wirkung, wie ein unvorbereitetes […] Möchte der lange Todeskampf doch durch Bewusstlosigkeit gemildert worden sein!! Als ich vor 3 Tagen dem König und der Königin […] von Ihren Leiden, von Ihrer Unsichtbarkeit auch für den nächsten Freund und Verehrer Ihrer Familie sprach, so befahl der König sogleich mit inniger Theilnahme für Sie und die theure Mutter , dass man schicken und womöglich Hofnungen {sic) einfordern solle. Die Theilnahme ist eine wahre, ungeheuchelte; die Grossartigkeit des Charakters Ihrer Mutter (ich weiss keinen mehr charakterisierenden Ausdruck) hat Eindrücke hinterlassen, die in das Jugendalter des Monarchen hinaufsteigen. Wie wohlhtuend ist der Gedanke, dass Ihre Anwesenheit den letzten Tagen noch Erquickung hat darbieten können […] Möge Ihre herrliche Gattin unser Flehen unterstüzen [sic], dass Sie sich nicht in eine Trauer versenken, die Ihre Gesundheit gefährdet; dass Sie in Ihrem nächsten Familienkreise den Trost finden mögen, den der Anblick blühender Jugendkraft und schöner