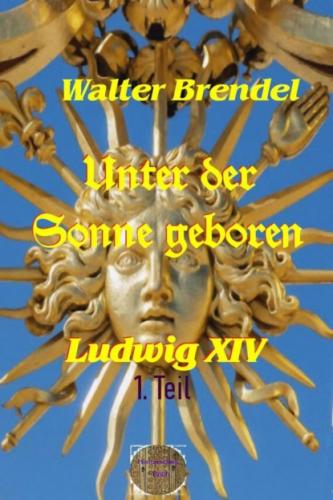***
Auch an jenem Regentag, als Ludwig zu seinem Vater befohlen wurde, trug er ein Kleidchen aus hellgrüner Spitze mit breiten Seidenmanschetten und einer seidenen Schürze. Dazu ein Spitzenhäubchen, dessen Bänder seine Gouvernante Madame de Lansac unter seinem Kinn quälend fest verknotet hatte, damit die Ohren des Kindes brav bedeckt blieben und die gestrenge Majestät keinen Grund zur Klage fand.
Fast jeden Tag verlangte sein Vater, ihn zu sehen. Nicht zu einer bestimmten Stunde, sondern immer dann, wenn es ihm gerade passte. Dann schickte er seinen Kammerdiener in die Gemächer der Königin. Ein Klopfen an der Tür genügte, und Ludwig wurde weggerissen von dem, was er gerade tat. Man weckte ihn oder schlug ihm den Löffel aus der Hand. Man zerrte ihn von seinen Spielen fort oder hob ihn aus der Wanne und streifte ihm gewaltsam eines der Besuchskleidchen über, gegen die er sich wehrte, weil er längst aus ihnen herausgewachsen war. Niemand kümmerte sich darum, dass er schrie und weinte. Was zählte, war allein der Wille seines Vaters, des Königs.
Einmal würde Ludwig selbst König sein, hatte ihm seine Mutter erklärt, und er hatte längst begriffen, was das bedeutete: Niemand würde mehr das Recht haben, ihn zu stören oder ihm auch nur zu widersprechen. Was er verlangte, würde geschehen. Doch dafür musste sein Vater erst sterben. Wenn Madame de Lansac ihn über die Korridore schleifte und in die Bibliothek seines Vaters schob, presste Ludwig das Kinn gegen die Brust, starrte trotzig auf die Füße des Vaters und wünschte seinen Tod herbei.
Der kleine Ludwig
Es war immer das Gleiche: Sein Vater versuchte, ihn für sich zu gewinnen. Er zeigte ihm Bücher und Landkarten und schenkte ihm Zinnsoldaten, Bälle oder ein Holzschwert. Doch der Knabe in seinem Mädchengewand hob nicht einmal den Blick, sondern wartete nur darauf, dass die Enttäuschung des Vaters in einen seiner Hustenanfälle mündete, an denen er fast erstickte und die endlich dafür sorgten, dass er von seinem Sohn abließ.
Seit zwanzig Jahren schon zerfraß die Tuberkulose Lunge und Darm des Königs. Die Schmerzen ließen ihn die Welt hassen und den Tod herbeisehnen. Erst ein heftiger Regensturm, der ihn eines Nachts im Louvre bei der damals von ihm getrennt residierenden Königin festhielt, hatte das Wunder vollbracht, dass er sich trotz seiner Abneigung neben ihr zur Ruhe legte. Alle im Schloss beteten, dass endlich ein Thronfolger gezeugt würde, und so geschah es auch. Ludwig kam zur Welt, ein Kind der Kälte und der Zwietracht, und doch gesund und kräftig wie kaum ein anderes. Zwei Jahre später wiederholte sich das Wunder. Die Glocken läuteten, als der Sonnenschein Philippe den ersten Schrei tat.
„Nun sind wir doppelt abgesichert“, sagte der König ungewohnt versöhnlich zu seiner Gemahlin, die abgekämpft in ihrem Bett lag. Sie antwortete nicht. Noch immer dröhnten in ihren Ohren die Worte, die er zum Arzt gesprochen hatte, als ihre Bedrängnis am größten war: „Retten Sie das Kind! Die Mutter werden wir ver-schmerzen können.“
Sie hasste ihn, und er hasste sie, und ihr älterer Sohn stand auf Seiten der Mutter. Erst wenn der Vater nach Luft rang und sich vor Schmerzen krümmte, entspannte sich das Kind, und erst wenn der König um sein Leben kämpfte, lächelte der Kleine.
Ein einziges Mal entdeckte der König dieses Lächeln. Mitten in einem der quälendsten Erstickungsanfälle, die er je erlebt hatte, fiel sein schmerzverschleierter Blick auf das Kind, das vor ihm stand und ihn voller Genugtuung beobachtete wie ein Insekt, dem man die Beine ausgerissen hat. Wäre er jetzt gestorben, das Begriff der König in seiner Not, das Kind hätte gelacht.
Von einem Augenblick zum anderen hörte der Anfall auf. Mit einem endlos langen Atemzug füllte der König seine verkrampfte Lunge. Ein paar Mal keuchte er noch, den Mund weit geöffnet. Dabei beobachtete er seinen Sohn, der sofort seinem Blick auswich und wieder zu Boden starrte.
„Du kleiner Teufel!“, flüsterte der König heiser und vergaß, dass er sich einst über die Geburt dieses Kindes gefreut hatte! Gefreut bis zur Glückseligkeit. „Dieudonne“ hatte er als zweiten Namen für den Knaben bestimmt. Der Gottgeschenkte - obwohl seine Gemahlin vorsichtig Einspruch dagegen erhoben hatte, weil es im Volk Brauch war, unehelich Geborene so zu nennen. „Ich werde dich lehren, mich so anzusehen!“ Die Stimme des Königs gewann an Kraft. „Ich werde dich wegholen von deiner Mutter und ihren albernen Weibern, die dich aufhetzen. Du wirst noch lernen, wem du zu gehorchen hast.“
Das Kind sah ihn nicht an. Da packte der König sein Kinn und riss es hoch, dass die Wirbel im Nacken leise knackten. „Schau mich an!“, schrie er. „Schau mich an, deinen König, dem du alles verdankst!“
Doch Ludwig presste die Lider zusammen. Tränen traten aus seinen Augenwinkeln, aber kein Ton kam über seine Lippen. Da ließ ihn der König los, holte aus und schlug ihn auf die Wange, dass das Kind zu Boden stürzte. Gleich jedoch raffte es sich wieder auf, rannte zur Tür, riss sie auf und floh hinaus auf den Korridor.
Die Wache eilte herein und wartete auf einen Befehl. Doch der König saß zusammengesunken auf seinem großen Sessel und starrte zu Boden. „Kümmert euch nicht um ihn!“, sagte er dumpf. „Ich will ihn nicht mehr sehen.“
Unterdessen stolperte Ludwig schluchzend den Korridor entlang. Weg, nur weg von seinem Vater, dessen Zorn er mehr fürchtete als alles andere! So jung er noch war, begriff er doch, dass er Schuld auf sich geladen hatte, als er die Leiden des Vaters verspottete. Täglich wurde ihm eingeschärft, es sei das strengst aller Gebote, Vater und Mutter zu ehren. Die Mutter sagte es ihm, bevor sie ihn seinen Besuchen in der königlichen Bibliothek überließ. Der Kardinal Mazarin sagte es ihm und auch die Kammerfrauen. Alle. Es war eine Todsünde, den Vater nicht zu ehren. Man kam in die Hölle, wenn man gegen das göttliche Gebot verstieß. Wie es aber in der Hölle zuging, war das Erste was man Ludwig gelehrt hatte.
In seiner tiefen Bedrängnis verfehlte Ludwig die Tür zu den Gemächern seiner Mutter. Sein Schluchzen verstummte. Er blieb stehen und sah sich um. Es war dämmrig geworden, und er fand sich nicht mehr zurecht. Die Welt war grau und unheimlich. Niemand war da, ihn zu begleiten und zu beschützen.
Vielleicht dachte er, hatte man ihn schon aufgegeben, und er würde in aller Ewigkeit durch die finsteren Gänge irren und nirgendwo mehr ankommen.
Unendlich lang erstreckte sich der Korridor mit sein vielen Abzweigungen, von denen Ludwig nicht wusste, wohin sie führten. Nirgends ein Geräusch oder eine menschliche Stimme. Ein riesiger Palast voller Menschen, doch in diesem Trakt hatte Stille zu herrschen, um die Majestäten nicht zu stören. Wäre jetzt eine Kerze aufgeflackert, hätte Ludwig geglaubt, sie würde sofort zur Flamme werden und er wäre wahrhaftig in der Hölle angelangt als Strafe für seine Sünden. Mit dem Rücken zur Wand rutschte er zu Boden. Noch immer zuckte das Schluchzen in seiner Brust, doch seine Tränen waren versiegt. Er überlegte, ob es helfen würde zu beten, aber nach seinen Verfehlungen würde Gott ihn gewiss nicht hören.
Ludwig als Dauphin
Er wollte nicht mehr geschlagen werden, und er wollte nicht von den Frauen weggeholt werden in die raue Männerwelt des Vaters, die ihm unheimlich war. Ludwig mochte Männer nicht, besonders nicht, wenn sie alt waren und meinten, ein barscher Befehl genüge schon, dass ein Kind alles tat, was sie wollten. Bevor Ludwig an diesem Abend einschlief, dachte er, wie es wäre, einen Freund zu haben. Aber Könige hatten keine Freunde. Das zumindest hatte er von seinem Vater gelernt.
Im Laufe der Zeit gelangte Ludwig zu dem Schluss, dass sein Vater eigentlich gar kein richtiger König war, zumindest war er nicht so, wie ein König sein sollte. Wie ein solcher sich verhielt, wusste Ludwig genau, seit Madame de Lansac angefangen hatte, ihm vor dem Einschlafen Märchen vorzulesen, in denen es immer nur um Könige ging, um Prinzen, wie Ludwig selbst einer war, und um wunderschöne Prinzessinnen, die schwere Prüfungen zu bestehen hatten, bis sie endlich das große Glück an der Seite eines liebenden Gatten