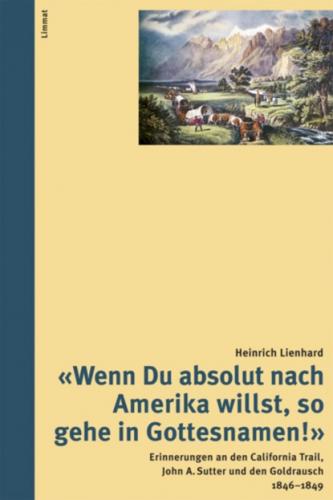Im Schriftbild lassen sich zwei Arten von Veränderungen feststellen: Der plötzlich feinere Strich verrät eine neue Feder, die kräftigere Farbe neue Tinte, ein über kurze Zeit leicht veränderter Schriftzug eine längere Unterbrechung. Die zweite Veränderung vollzieht sich langsam und weist voraus auf Lienhards Altersschrift: Der zügige, nach rechts gerichtete Duktus weicht einer grösseren, fast aufrechten und weniger regelmässig wirkenden Schrift mit weit ausholenden Bogen und Schleifen. Die langsam abnehmende Zeilenzahl pro Seite (vier bis fünf Zeilen) gegen Ende des Manuskripts bestätigt den optischen Eindruck.
Zu Beginn der 1890er-Jahre bereitete Lienhard sein Manuskript für die von Caspar Leemann geplante Buchausgabe vor. Wohl um seinem Freund die Übersicht zu erleichtern, notierte Lienhard auf dem linken Rand der Vorderseite jedes Bogens stichwortartige Inhaltsangaben zum betreffenden Bogen. Sie stehen quer zum Haupttext und sind bis Bogen 59 mit hellroter Tinte verfasst. Bogen 60, 63 und 64 enthalten je einen Titel mit Bleistift und einer neuen, roten Tinte; auf den Bogen 65 bis 238 sind ursprüngliche Bleistifttitel mit roter Tinte überschrieben. Bogen 73 enthält zusätzliche Inhaltsangaben auf den Seiten 3 und 4, Bogen 127 auf Seite 4. Diese Zusätze weisen auf besonders wichtige Ereignisse hin: auf dem California Trail das Ende des Hastings Cutoff beziehungsweise die Ankunft am Mary’s River, in Kalifornien die Goldentdeckung.
Während Lienhard zur Formulierung der Inhaltsangaben den Haupttext wieder las oder zumindest überflog, brachte er – alles hier Folgende mit roter Tinte – kleine orthografische und stilistische Korrekturen an. Sie zeigen, dass er sich bemühte, Leemann für die Edition von 1898 einen sprachlich möglichst korrekten Text zur Verfügung zu stellen. Neben Seiten ohne Emendationen gibt es Seiten mit über einem Dutzend davon, wobei diese nicht in jedem Fall eine Verbesserung darstellen. Lienhard war damals über siebzig, sein Deutsch war unsicherer und der Einfluss der englischen Sprache grösser geworden, wie sich beispielsweise dort zeigt, wo er «Schäferei» zu «Schäferey» korrigierte. Längere fremdsprachige Dialoge hob er durch Unterstreichung hervor, vielleicht weil er davon ausging, dass sein Freund diese Stellen übersetzen lassen würde.
Lienhards Altersschrift ist zwar immer noch gut lesbar, wirkt jedoch ungelenker und stellenweise etwas zittrig. Besonders gut zeigt sich dies bei dem separaten Inhaltsverzeichnis, das er durch Übertragen der Inhaltsangaben von den Bogen auf vier Einzelblätter erstellte. Von den 238 Angaben sind 71 praktisch wörtlich übernommen, die anderen enthalten Umformulierungen oder Kürzungen, nur deren zehn einen Zusatz. Dieses separate Inhaltsverzeichnis ist deshalb von besonderem Interesse, weil daraus hervorgeht, dass das Manuskript ursprünglich vier oder fünf Bogen mehr als die überlieferten 238 umfasste. Sie enthielten persönliche Familienerinnerungen, und schon auf dem letzten erhaltenen Bogen drückte Lienhard unmissverständlich den Wunsch aus, dass der noch folgende Text von niemandem ausserhalb seiner Familie gelesen werden solle. Um dies zu betonen, strich er auf Bogen 238 die letzten zweieinhalb Seiten durch, ebenso die entsprechenden Inhaltsangaben im separaten Inhaltsverzeichnis. Sie lauten wie folgt: «Bekannt werden mit meiner zukünftigen Frau/Hochzeitsreise/Heimkehr/Maria Einsiedeln/Kaufe in Kilchberg».
Lienhard war ein gewissenhafter Erzähler und dürfte sein Manuskript nicht ohne einen Hinweis zur Zeit und Dauer der Niederschrift abgeschlossen haben. Durch den Verlust der letzten Bogen bleibt heute nur der Versuch, anhand einiger Angaben im Haupttext sowie Randbemerkungen aus späterer Zeit einen gewissen zeitlichen Rahmen zu finden. Da unbekannt ist, wie regelmässig er schrieb und wie viele Bogen pro Monat er füllte, handelt es sich dabei immer nur um eine Schätzung. Ein erster Hinweis findet sich auf Bogen 20, wo Lienhard sich an den Moment Ende November 1843 erinnert, als er das Wort «California» zum ersten Mal hörte. Er schreibt dort, dass seit jenem Abend «über 30 Jahre» verflossen seien. Da er auf Bogen 24 mit Bezug auf die Monate Februar und März 1844 «30 Jahre» nennt, dürfte er gegen Ende 1873 mit Schreiben begonnen haben. Die letzten beiden Hinweise finden sich auf den Bogen 215 und 216, wo er von Erlebnissen im Juni 1850 erzählt und beide Male erwähnt, dass seither «nahezu 27 Jahre» vergangen seien. Das heisst, er war im ersten Halbjahr 1877 auf Bogen 216 (von 242) angelangt. Angenommen, er verfasste die letzten 26 Bogen ohne grössere Unterbrechung, dürfte er seine Schreibarbeit somit nach rund vierjähriger Dauer gegen Ende 1877 abgeschlossen haben.
Die Frage, inwieweit Lienhard sich beim Schreiben auf Tagebücher stützte, lässt sich nur für die Reise nach Kalifornien mit Sicherheit beantworten, da er dort ein Tagebuch ausdrücklich erwähnt. Korns/Morgan, die anlässlich ihrer Untersuchung zu einem Abschnitt des California Trails nach dem Original-Tagebuch forschten, erfuhren von Lienhards Enkelin, dass ausser dem Manuskript weder das Trail-Tagebuch noch andere Notizen überliefert worden seien.
Lienhards Schreibstil zeigt jedoch einen der Genauigkeit und Verlässlichkeit derart verpflichteten Erzähler, dass für mehrere Abschnitte zumindest von tagebuchartigen Notizen als Vorlage ausgegangen werden muss. Nicht nur halten seine Angaben mit geringfügigen Ausnahmen allen Vergleichen mit anderen zeitgenössischen Quellen stand, sondern sein Text enthält auch Abfahrts- und Ankunftsdaten, Namen von Mitreisenden, Schiffen und Hotels, an die er sich selbst bei überdurchschnittlichem Gedächtnis nach dreissig Jahren kaum hätte erinnern können. Sein Manuskript zeigt jedenfalls, dass er über seine Reise in die Schweiz 1849/50 und die letzten Monate in Kalifornien, als er nicht mehr arbeiten musste, ebenso ausführlich berichtet wie über den Trail, so dass ihm vermutlich Notizen zur Verfügung standen. In den Erinnerungen an die Jahre, in denen er arbeitete, beschränken sich präzise Zeitangaben oft auf Feiertage wie den 4. Juli oder 1. Januar, während ungefähre Angaben wie «eines Tages im Monat August» und Einschränkungen von der Art «wenn ich nicht irre» oder «wenn ich mich recht erinnere» relativ häufig anzutreffen sind.
Heinrich Lienhards Manuskript, das heute in der Bancroft Library in Berkeley aufbewahrt wird.
Einer Randbemerkung aus dem Jahr 1901 ist zu entnehmen, dass Lienhard sein Manuskript bei sich zu Hause in Nauvoo aufbewahrte und auch immer wieder darin las. Nach seinem Tod 1903 ging es in den Besitz seines jüngsten Sohnes Adam H. Lienhard über, der es seiner Tochter Vivian Magnuson-Lienhard weitergab. Mrs. Magnusons Wunsch, das Erinnerungswerk ihres Grossvaters sicher und fachgerecht aufbewahrt zu wissen und es trotzdem öffentlich zugänglich zu machen, veranlasste sie 1949, es der Bancroft Library in Berkeley zu verkaufen.
Der geschichtliche Hintergrund
Kalifornien
Bis zum Jahr 1539 der christlichen Zeitrechnung war die Welt Kaliforniens von Kontinuität geprägt. Seine menschlichen Siedlungen haben eine über zehntausendjährige Geschichte und sind älter als in anderen nördlichen Gebieten der westlichen Hemisphäre. In den archäologischen Überresten tritt eine grosse kulturelle Vielfalt zutage, und über hunderttausend Fundorte von Lagerstellen bis zu komplexen Siedlungen und städtischen Zentren bezeugen die Vergangenheit des Landes vor dem weissen Einfall.
Drei geografische Faktoren waren bestimmend für die Geschichte Kaliforniens. Dies waren seine isolierte Lage, das in vielen Regionen milde Klima und der Reichtum seiner Landschaften. An der Küste sorgt das Meer für kühle Sommer, warme Winter und über das ganze Jahr für feuchte Luft. Im grossen Central Valley und in anderen Inlandtälern dagegen sind die Temperaturschwankungen gross, in Wüstengegenden extrem. Am Fuss der Sierra Nevada ist das Klima nebelfrei und in Berggegenden stellenweise dem Alpenklima ähnlich. Der nach Alaska und Texas drittgrösste Staat der Vereinigten Staaten hat eine 2000 Kilometer lange Küste, und die extremen Höhenunterschiede liegen zwischen 86 Meter unter Meer in Badwater im Death Valley und 4418 Meter auf dem Gipfel von Mount Whitney, wobei die beiden Punkte nur knapp hundert Meilen auseinanderliegen.
Die indianischen Völker
Wie andere menschliche Gemeinschaften entwickelten Kaliforniens einheimische Bewohner Lebensformen, die sich den Möglichkeiten von Klima und Bodenbeschaffenheit anpassten. Die Pflanzenwelt wurde durch gezielten Einsatz von Feuer gepflegt und die Tierwelt in ihrem eigenen Habitat genutzt, also Vielfalt, Produktivität und Schutz der Nahrungsquellen bewusst gefördert. Nur im südlichsten Teil und äussersten