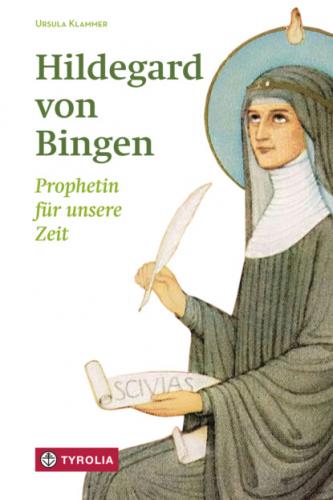Abtei St. Hildegard in Rüdesheim/Eibingen – An das 1802 aufgelassene und später abgerissene Kloster Eibingen erinnert die 1904 errichtete Abtei St. Hildegard, wo heute inmitten der Weinberge noch fast 60 Benediktinerinnen das geistige Erbe ihrer berühmten Vorgängerin weitertragen.
Neben der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem literarischen und künstlerisch-musikalischen Vermächtnis der Hildegard von Bingen führen die Ordensfrauen unter anderem einen gut sortierten Buchladen, in dem neben dem reichen Angebot an Literatur auch Kunstgegenstände verschiedenster Genres verkauft werden.
Wein aus eigenem Anbau (aufgrund hervorragender Qualität mehrfach prämiert) kann zusammen mit anderen Edelweinen bzw. Getränken sowie allerlei kulinarischen Spezialitäten in einem kleinen Laden entlang der Frontfassade verkostet und erworben werden. Auch eine Goldschmiede und ein Keramikatelier sowie eine Restaurationswerkstätte für kirchliche Archivalien befinden sich innerhalb der weitläufigen Klostermauern. Ein Gästetrakt beherbergt Frauen und Männer, die sich für einige Zeit zurückziehen möchten, um sich der Stille und inneren Sammlung hinzugeben. Die Gebetshoren und liturgischen Angebote der geistlichen Schwestern stehen für Gäste des Klosters sowie für Besucherinnen und Besucher von auswärts offen.
Bei den Feierlichkeiten rund um die Ernennung Hildegards zur „Lehrerin der Universalkirche“ würdigte Papst Benedikt die mittelalterliche Benediktinerin als Frau mit einem „prophetischen Geist“ und einer „ausgeprägten Liebe zur Schöpfung“. Beim Festakt verwies er unter anderem auf ihren „wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Kirche ihrer Zeit“ sowie auf ihre „herausragende Lehre“. Ihre beachtlichen Verdienste auf dem Gebiet der Glaubensweitergabe stellen eine der insgesamt vier Bedingungen dar, die für eine Erhebung zur Kirchenlehrerin erfüllt sein müssen. Der deutsche Papst würdigte die Benediktinerin als eine Frau von „lebhaftiger Intelligenz“ und „tiefer Sensibilität“, die als „anerkannte geistliche Autorität“ immer eine „große und treue Liebe“ zu Christus und der Kirche bewahrt habe.
Hildegards literarische Hinterlassenschaft
Neben ihren Zuständigkeiten als geistliche Leiterin zweier Schwesternkonvente und zugleich als Verwalterin zweier Klosteranlagen findet die Äbtissin erstaunlicherweise auch noch Zeit für schriftstellerische Tätigkeiten. Hildegard versucht ihrer Berufung als Seherin und Prophetin gerecht zu werden, indem sie ihre Visionen – die enorme Fülle des Gehörten und Geschauten – in Worte kleidet und in der Folge möglichst vielen Menschen zugänglich macht. Der lateinkundige Mönch Volmar steht ihr dabei als Sekretär und wohl auch als geistlicher Berater zur Seite. Er versteht es, die vielbeschäftigte Äbtissin immer wieder zum Weiterschreiben zu ermutigen. Bis zu seinem Tod im Jahre 1173 bleibt er ihr ein treuer Weggefährte. Über viele Jahre bemüht sich Volmar, Hildegards mangelhaftes Latein zu verbessern, ohne dabei inhaltliche Änderungen an ihren Texten vorzunehmen.
Schon zu Lebzeiten Hildegards hat der fromme und gelehrte Mönch mit den Aufzeichnungen einer Hildegard-Vita begonnen. Nach seinem Tod übernimmt Mönch Gottfried seine Aufgaben als Sekretär und Propst im Kloster Rupertsberg. Von ihm stammt der Großteil der Vita der hl. Hildegard. Seine Aufzeichnungen werden später – kurz nach Hildegards Tod – von Theoderich, einem Mönch aus Echternach, für die Abfassung seiner Vita s. Hildegardis Virginis benützt. In diesem Werk finden sich auch autobiografische Fragmente, die Hildegard zwischen 1167 und 1169 verfasst haben dürfte. Nach dem frühen Tod Gottfrieds lässt sich Wibert von Gembloux, ein Bewunderer Hildegards aus den Niederlanden, von seinem Kloster freistellen, um die für ihn ehrenvolle Aufgabe als Sekretär auf dem Rupertsberg zu übernehmen. Auch Wibert – ein überdurchschnittlich gebildeter Mönch – hat während seiner Jahre in Hildegards Kloster mit dem Verfassen einer Vita begonnen. Diese ist zwar Fragment geblieben, wurde aber in die von Theoderich zusammengestellte Vita eingearbeitet.
Bei einer Vita handelt es sich nicht um eine vollständige (historische) Dokumentation eines Lebensweges, sondern um eine bewusste Auswahl von staunenswerten Begebenheiten aus dem Leben eines Heiligen bzw. einer Heiligen. Angesichts der manchmal etwas überzeichneten Beschreibungen ihres Lebensweges sollte die Äbtissin als geistbegabte und charismatische Persönlichkeit in die Geschichte eingehen. Insofern soll eine Vita auch zur Erbauung der Leserschaft und zum Lobpreis Gottes beitragen. Darüber hinaus leistet sie einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zu einer Heiligsprechung.
Skulptur der hl. Hildegard, Abtei St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen, Bronze von Karl-Heinz Oswald.
Die Äbtissin wird als Frau mit einer schmalen, zerbrechlichen Gestalt und hagerem Gesicht dargestellt. Ihre geschlossenen Augen könnten innere Sammlung, konzentriertes Nachdenken oder kontemplatives Betrachten ausdrücken.
Hildegards umfangreicher Briefwechsel, der sich über 33 Jahre erstreckt, bezeugt das große Vertrauen und Ansehen, das Hildegard innerhalb der verschiedensten gesellschaftlichen Schichten genießt. Hochrangige Persönlichkeiten wie Päpste, Kardinäle, Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen sowie weltliche Würdenträger bis hinauf zu den Kaisern Friedrich Barbarossa und Konrad wenden sich an die geistbegabte Nonne vom Rupertsberg, um von ihr Rat und Hilfe in unterschiedlichsten Angelegenheiten zu erhalten. Die lange Liste an Adressatinnen und Adressaten lässt auf den hohen Bekanntheitsgrad der Äbtissin vom Rupertsberg schließen. Auch Gräfinnen und Fürstinnen, ja sogar die griechische Kaiserin und die englische Königin finden sich unter ihnen. Nicht selten wird von der visionär begabten Nonne ein prophetisches Wort, eine weise Beurteilung in wichtigen politischen oder persönlichen Angelegenheiten erbeten – manchmal auch vor wichtigen Entscheidungen.
Die zahlreichen Briefe an Hildegard bleiben nicht unbeantwortet: Neben ihren vielen anderen Verpflichtungen bemüht sich Hildegard, die Wünsche und Fragen all derer zu beantworten, die sich vertrauensvoll an sie wenden. Viele Menschen bitten um ihre Fürsprache bei Gott oder um Trost in ihren unterschiedlichen Bedrängnissen.
Hildegard – die Heilkundige
Im Prolog ihres zweiten Visionsbuches Der Mensch in der Verantwortung erwähnt Hildegard, dass sie zwischen 1151 und 1158 eine Schrift mit dem lateinischen Titel Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum verfasst hat. Es handelt sich um ein Buch von dem inneren Wesen der verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Von diesem naturheilkundlichen Sammelwerk existieren nur noch spätere Abschriften. Diese hinsichtlich ihrer Überlieferungsgeschichte jüngeren Handschriften sind im Gegensatz zum Original nicht mehr als ein einheitliches Ganzes erhalten, sondern sie liegen uns heute in zwei Teilen vor: einerseits das Buch Physica (übersetzt: Die Heilkraft der Natur) und andererseits Causae et Curae (Über die Ursachen und die Behandlung von Krankheiten).
In diesen beiden Werken leuchtet eine tiefgründige Kenntnis von Mensch und Natur – gleichsam der gesamten Schöpfung – auf. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten auf den Gebieten der Heil- und Naturkunde erhält Hildegard von Bingen später den Ehrentitel der „ersten deutschen Naturforscherin und Ärztin“. Hildegards große Kenntnis und Wertschätzung der Natur spiegelt sich auch in ihrer Dichtung wider. Pflanzen, Tiere und Edelsteine erhalten in den bildreichen Texten und Liedern häufig eine symbolische Bedeutung. Damit weisen sie in ihrer Vielfalt auf heilsgeschichtliche Zusammenhänge hin.