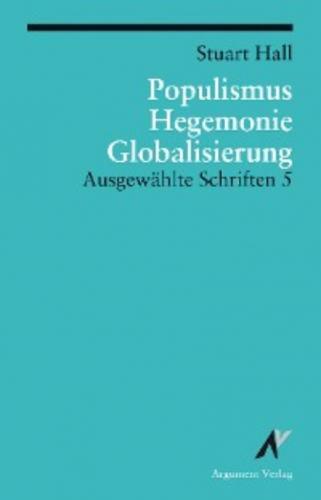Der Staat kann nicht völlig außerhalb der sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Verhältnisse und Institutionen der Gesellschaft stehen. Eine seiner Hauptfunktionen ist das Bewahren von Recht und Ordnung; aber die ›Ordnung‹ in einem kommunistischen Staat ohne Privateigentum und mit seiner Verschmelzung von Wirtschaft und Politik ist sehr verschieden von der Ordnung in westlich-liberalen kapitalistischen Gesellschaften, die auf Privateigentum, Lohnarbeit, Transaktionen am Markt und der formellen Trennung zwischen Wirtschaft und Politik gründen. Staaten ›erhalten‹ nicht bloß die ›Ordnung‹ aufrecht. Sie erhalten besondere Formen der gesellschaftlichen Ordnung aufrecht: eine bestimmte Reihe an Institutionen, eine bestimmte Ausgestaltung von Machtverhältnissen, eine bestimmte Sozialstruktur und Wirtschaft. Der ›leere‹ Staat – ein Staat ohne gesellschaftlichen Inhalt – existiert nicht.
Da der Staat aus einer spezifischen Ausgestaltung sozio-ökonomischer Verhältnisse und Institutionen entsteht, reflektiert er bei seinen Staatshandlungen die Form, Struktur und Ausgestaltung dieser gesellschaftlichen Formationen. Eine feudale Gesellschaft kann nicht von einer kapitalistischen Staatsform regiert werden. Der kapitalistische Staat basiert auf einer Gesellschaft und ist für eine solche geeignet, die über Kapitalverkehr funktioniert: in der die Wirtschaft hinsichtlich ihrer Profitabilität beurteilt wird, wo Einnahmen von der systematischen Erhebung von Steuern abhängen, wo die Macht›pyramide‹ sich aus den Klassen der modernen Industriegesellschaft heraus bildet, nicht aus feudalen Ständen; und die allgemeine Gesinnung ist nicht religiös, sondern säkular und individualistisch mit einem demokratischen oder ›egalitären‹ Ethos. Trotz der formalen Trennung zwischen Wirtschaft und Politik gibt es gewichtige Gründe, warum beide bis zu einem gewissen Grad dazu tendieren, sich zu entsprechen.
Der Staat ist demnach nicht autonom gegenüber der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass der Staat in Form und Funktion gänzlich durch die Gesellschaft bestimmt wird. Es gibt komplexe Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen zwischen der Form des Staats und der Art der Gesellschaft. Aber der Staat wird von der Gesellschaft mit der ultimativen Macht der höchsten Autorität ausgestattet, autorisiert, über der Gesellschaft zu stehen und sie zu regieren. Der Staat lässt sich nicht vollständig auf die Gesellschaft reduzieren. Etwas ist hinzugefügt, wenn Macht in der Gesellschaft in einer separaten und besonderen Herrschaftsinstanz organisiert wird. Aus dieser Perspektive scheint es klar, dass der Staat die Gesellschaft konstituiert, wie auch er selbst von ihr konstituiert wird. Staaten sind somit nicht autonom gegenüber der Gesellschaft. Sie sind nur ›relativ autonom‹.
Diese Frage, ob der Staat gegenüber der Gesellschaft autonom oder auf sie reduzierbar ist, ist eins der wichtigsten Kritierien, um die verschiedenen Theorien über den Staat voneinander zu unterscheiden. Schlichte pluralistische Theorien gehen davon aus, dass der Staat weitgehend autonom ist. Inputs von konkurrierenden Interessengruppen münden in den Staat ein: der Staat agiert als Schiedsrichter zwischen ihnen. Seine Neutralität gegenüber den verschiedenen Interessengruppen der Gesellschaft wird durch seine Separatheit und Autonomie garantiert. Schlichte marxistische Theorien wiederum halten den Staat für ein Werkzeug der herrschenden Klasse. Sein Gehalt, sein Ziel und seine Strategie sind identisch mit denen der herrschenden Klasse. Seine Funktion ist die Verwaltung der Gesellschaft zugunsten der Interessen der herrschenden Klasse. Seine ›Separatheit und Autonomie‹ sind eine Illusion, ein Trick, um die Machtlosen zu täuschen, damit sie denken, der Staat sei neutral und stünde über und neben solch verkommenen Vorgängen. Staatstheorien schwanken weitgehend zwischen diesen zwei Polen der ›Autonomie‹ und ›Identität‹.
Repräsentation und Konsens
Der Staat ist in gewisser Weise ›repräsentativ‹ gegenüber der Gesellschaft. Aber Repräsentation ist ein schlüpfriger Begriff. Der absolute Monarch fühlte, dass er ›der Vater seines Volkes‹ war und die Pflicht hatte, sein Volk zu behüten, sich um seine Wohlfahrt zu kümmern und seine Interessen zu vertreten. Aber das gemeine Volk hatte keine formalen Rechte der Repräsentation. Repräsentation ist nie ein einfacher, transparenter Prozess. Ein Abgeordneter des Parlaments mag sich Ihre Sichtweisen anhören und versuchen, ›diese‹ so gut er oder sie kann zusammen mit den Standpunkten anderer im Parlament zu ›repräsentieren‹. Aber es wäre naiv zu glauben, dass er oder sie das, was Sie sagen oder wünschen, direkt und ohne Modifikation weitervermittelt. Politiker und Politikerinnen können das Volk allgemein in dem Sinne ›repräsentieren‹, dass die einzelnen Bürger und Bürgerinnen etwas Bestimmtes erwarten – z. B. verschärfte Gesetze, Sicherheitspolitiken, die Wiedereinführung der Hinrichtung durch den Strang – wobei ›diese Einzelnen‹ nicht wissen, dass sie dies wollten, bevor es für sie formuliert wurde.
Die Vorstellung, dass der Staat bezogen auf ›Repräsentativität‹ und ›Konsens‹ definiert werden sollte, spielte für den Staatsbegriff bis zu den bürgerlichen Revolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts keine Rolle. Der wesentliche Bruch erfolgte mit Hobbes, der begann, Individuen als eigenständige, besitzergreifende und eigennützige Einheiten im ›Naturzustand‹, in Abwesenheit jeglicher Gesellschaft zu fassen und, daran anschließend, den Staat als Ergebnis eines Gesellschaftsvertrages zwischen einwilligenden Individuen zu erklären.
Seit diesem Zeitpunkt stand das Regieren im Einverständnis im Zentrum der modernen Vorstellung vom Staat. In der liberalen Theorie wurde dies gänzlich individualistisch bestimmt. Die Klasse derer, deren Einverständnis zählte, war strikt beschränkt – obgleich dieses Einverständnis der Bevölkerung mittels einer universellen Sprache von ›Rechten und Freiheiten freier Engländer‹ zugestanden war. John Locke definiert ›Individuen‹ als besitzende Individuen und meint damit Männer. Frauen, nicht vermögende Arbeiter oder Dienerschaft sind nicht einbezogen. »Mit dem Ausdruck ›freie Männer‹ meinten die Whigs immer einen Mann mit eigenem Vermögen.« (Dickenson 1977: 68)
›Konsens‹ ist ein kritisches Konzept für alle Gesellschaftsverträge und liberalen Staatstheorien. Aber seine Bedeutung bleibt mehrdeutig. Muss Zustimmung positiv und begeistert sein? Kann Zustimmung stillschweigend, widerwillig, gewohnheitsmäßig erfolgen – oder erzwungen werden? Die Versöhnung der Theorie der Individualrechte und des Konsens mit der unveräußerlichen Tatsache der Staatsmacht bleibt seither eine heikle Frage für liberal-individualistische Staatstheorien.
Ein Staat sei notwendig, so argumentierte Hobbes, »um festzusetzen, auf welche Weise alle Arten von Verträgen zwischen Untertanen (wie Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Leihen, Pachten und Verpachten) abgeschlossen werden« (zit. n. Macpherson 1967: 114; vgl. Hobbes 1984: 131). Hiermit ist ein Grundstein liberaler Staatstheorien in Marktgesellschaften und -ökonomien identifiziert. Theorien des Gesellschaftsvertrages hoben diese neuen sozio-ökonomischen Bedingungen der Gesellschaft des 17. Jahrhunderts auf die Stufe eines abstrakten Prinzips. Hobbes hingegen konnte nicht erklären, wie seine Individuen im Naturzustand, in Abwesenheit jeglicher Gesellschaft, hinreichend »die gesellschaftlich erworbenen Verhaltensweisen und Begierden des Menschen« besitzen (Macpherson 1967: 35), die sie befähigen, ihre Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag zu formulieren. In Wirklichkeit werden Individuen nicht in ein natürliches Nichts hineingeboren, sondern in bereits funktionierende Gesellschaften, in bestimmte Sozialordnungen innerhalb gesellschaftlich geformter Verhältnisse und mit bereits bestehenden Pflichten gegenüber dem Staat. Ihre Zustimmung muss demnach ebenso gesellschaftlich geformt sein. Zudem muss Zustimmung nicht notwendigerweise spontan sein. Wir können machtvoll vom Staat beeinflusst werden, um zuzustimmen. Sie kann im wahrsten Sinne ›hergestellt‹ werden.
In liberalen Demokratien sind Konsens und Repräsentation oft untrennbar miteinander verbunden. Die konsensuelle Basis des Staates ist durch den formalen Prozess der repräsentativen Staatsführung besiegelt. Noch mal: das ›repräsentative‹ Wesen des Staates trat nicht zuerst mit der liberalen Demokratie auf. Die Armen und die Entrechteten konnten gegenüber den Mächtigen immer Beschwerden oder ›Bittgesuche‹ vorbringen. Absolute Herrscher fühlten sich verpflichtet, diese Repräsentationen anzuerkennen – wenn nicht zu einem anderen Zweck, dann um Rebellionen, Unruhen und Beutezügen vorzubeugen. Das System der Entsendung eines ›Vertreters‹ derer, die dem König Abgaben schuldeten oder