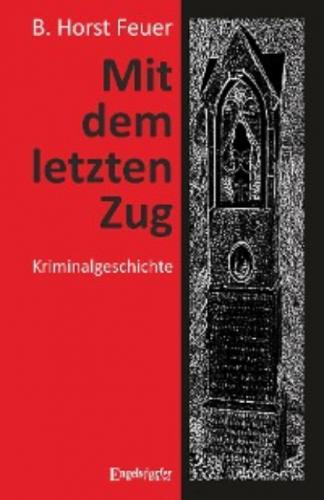Finkner genoss nun das Mahl mit bestem Appetit und zürpfelte reichlich einen guten Roten dazu. Er war bald in bester, ja geradezu euphorischer Stimmung, und der laue, warme Maienabend lockte ihn wieder hinaus ins Freie, er war aufgewühlt und unruhig und spürbar angeheitert. Er hatte vorher überlegt, ob er den Weg hinauf zur Wallfahrtskirche „Maria zu den Ketten“ gehen sollte, sich aber dann doch für einen Spaziergang außerhalb der Stadt, Richtung Alter Wald entschlossen, weil er den ganzen Tag über keine Bewegung gehabt hatte, wie er sich einredete, und weil Luft und Stimmung ihn nun geradezu aufforderten – er musste hinaus, es drängte und zog ihn. Ach, wie schön konnte das Leben sein.
Kurz vor acht Uhr kam er zurück.
Er machte sich auf dem Zimmer schnell frisch, zog sich um, und ging dann wieder hinunter in die Gaststube. „Typisch Schwarzwald“, dachte er, als er sich dort umblickte, ganz anders, als er es aus Karlsruhe kannte. Der ganz in dunklem Holz gestaltete Raum, das dunkle Mobiliar und das wenige Hell, das durch die kleinen, durch viele Sprossen noch weiter geminderte Licht übrig blieb, vermittelten dem Gast nun plötzlich ein etwas bedrückendes, düsteres Gefühl. „Komisch“, kam es ihm in den Sinn, „ich bin in der Sonne und alles ist so duster.“ Da kam schon der Wirt und fragte nach dem Begehr. Der war eine propere Erscheinung, er trug ein weißes Hemd und eine blaue Halbschürze und machte einen freundlichen und souveränen Eindruck. So stellte sich Finkner einen Patron vor. Er orderte einen Schoppen Wein, und während er gerade überlegte, sich zu den Einheimischen an den Stammtisch zu setzen, wie es seine Gewohnheit war und wo er sich gerne als der „hohe Herr aus Karlsruhe“ hofieren lassen würde, stürzte plötzlich ein junger Kerl in die Stube und fragte nach einem Mädchen. Ob jemand die Vroni Bucher aus dem Oberentersbach gesehen habe, wollte er wissen, und als keiner nichts wusste, stürmte er davon. Einem stillen Moment der Überraschung folgte lebhaftes Gemurmel, und Finkner erhob sich nun und ging hinüber und fragte, ob er sich ihrer Gesellschaft anschließen dürfte. Das Gemurmel erstarb, und einer der Gäste meinte: “Bitte schön, setzt Euch!“
Der Stammtisch vor der Theke bot Platz für sicher zehn Personen, doch saßen auf jeder Längsseite auf den dortigen Bänken je drei Männer. Die Herren besprachen lautstark das gerade Erlebte, und Finkner versuchte die Männer einzuordnen. Es belustigte ihn immer wieder, sich mit, wie er meinte, einfältigen oder gar dummen Menschen zu unterhalten, sie auszuhorchen und oft auch auf den Arm zu nehmen.
Einer war sicher ein Zeller Geschäftsmann, während er die anderen als Vorarbeiter oder Maler aus der nahen Keramikfabrik vermutete, auch wegen ihrer Kleidung.
Weiter kam er nicht, denn kaum dass er saß wurde wiederum die Tür aufgerissen, und mehrere Personen traten herein. Sie waren wohl alle den Anwesenden bekannt, und eine heftige Unterhaltung kam in Gang. Er erfuhr unschwer, dass ein zwölfjähriges Kommunionkind auf dem Nachhauseweg vom Städtle nach Oberentersbach verschwunden war und die Familie nach ihm suchte. Fast hätten sich die Stammtischler aufgemacht, um sich an der Suche zu beteiligen, doch der Wirt beschwichtigte sie, es müsse ja nichts Schlimmes passiert sein.
Es sei noch nicht so spät und ein guter Ausgang mit verständlichen Begründungen noch möglich, und doch schien es den Tischgenossen dann angeraten, den oder die Täter einer noch gar nicht feststehenden Tat zu finden. Ihrer Meinung nach waren es auf jeden Fall Auswärtige, entweder die Italiener vom „Hirschen“, Landstreicher oder sonst Durchreisende, das stand für sie fest, da waren sie sich einig. Es sei immer wieder das Gleiche mit dem Gesindel, man sollte die gar nicht ins Städtle lassen und gleich davonjagen. Die machten nur Scherereien, und man sei sich so langsam des Lebens nicht mehr sicher. Finkner duckte sich fast innerlich weg und machte sich schon Gedanken über ein vielleicht nötiges Alibi. Was es denn mit den Italienern vom „Hirschen“ auf sich habe, fragte er vorsichtig und um die Gedanken wieder auf die Ausländer zu bringen und erfuhr, dass nach einem verheerenden Großbrand in der Oberstadt im Jahr zuvor beim Wiederaufbau des Hotels „Zum Hirschen“ italienische Arbeiter und Maurer tätig seien. Da erkundigte sich der Erste nach seiner Herkunft und Verrichtung hier in Zell. Er befürchtete schon, sich vor allen rechtfertigen zu müssen; bevor es aber dazu kam, mischte sich sogleich der Wirt ein, der sich für seinen Gast wohl verantwortlich fühlte, und verbat sich jede Verdächtigung eines großherzoglichen Regierungsbeamten aus Karlsruhe. Seine Erklärung, dass der Beamte auf Dienstreise sei, und die Erwähnung der Keramik und des Namens Georg Schmider reichten dann, dass die Gesellschaft, es waren tatsächlich fünf Keramiker dabei, das Thema wechselte und die Einführung einer Betriebskrankenkasse, die Arbeitsbedingungen, die Einrichtung englischer Wasserklosetts und anderes mehr ins Gespräch kamen. Lebhaft und laut diskutierten die Männer über die Fabrik und das Problem der Holz- versorgung, und manch Schoppen fand den Weg in die Kehlen. Das vermisste Mädchen war vergessen, und erst als der Karlsruher zu später Stunde und ordentlich vom Wein berührt zu Bette ging, kam ihm dort wieder das Kind in den Sinn und er war nicht wenig beunruhigt.
Es war ihm stickig und schwül, und weil er nicht schlafen konnte, verließ er still und ungesehen das Haus, um draußen Zerstreuung zu suchen. Bei der Heimkehr lief er dann der Hausmagd über den Weg, und auch den Rest der Nacht fand er keinen erholsamen Schlaf.
Unruhig wälzte er sich im Bett, und als er dann endlich eingeschlafen war, ängstigte ihn ein Traum: Sein alter Pfarrer hatte ihn wieder einmal in der Mangel. Es war kurz vor seiner Erstkommunion. Im Unterricht ging es um die Beichte und um Tod und Teufel, Verdammnis, Hölle und Fegefeuer und er hatte furchtbare Ängste, die der Pfaffe schürte und die ihn ganz beherrschten.
„Man muss alles beichten, sonst kommt man in die Hölle, und dort ist Heulen und Zähneknirschen und das für immer und ewig!“, so hieß es. Gebot für Gebot wurde besprochen und speziell die Sache mit dem Geschlechtlichen kam ihm besonders wichtig und schlimm vor. Und das war das Problem: Zwei, drei Jahre zuvor – er hatte von all den Geboten gar nichts gewusst – hatte er eine Zeit lang mit der Rosi aus der Nachbarschaft öfter gespielt. Sie waren zusammen eingeschult worden und verbrachten im ersten Sommer manchen Nachmittag miteinander. Sie waren viel draußen, waren am Bach und auf den Feldern zur Turnhalle, und eines Tages, es war heiß und nach dem Baden hatten sie fast nichts an, erkundeten sie in einem Kornfeld gegenseitig ihre geschlechtlich unterschiedlichen Körperregionen. Mit einem Strohhalm erforschte er ihre Scham und fand alles neu, interessant und kribbelig.
Es passierte auch nie mehr und alles war gut. Bis, ja bis die Sache mit der Beichte über ihn kam. Immer und immer wieder hackte der Pfarrer auf dem Thema herum und bläute ihnen ein, wie schlimm solche Sachen seien und dass man alles, aber auch wirklich alles, und sei es noch solange her, unbedingt beichten müsse. So war ihm das Erlebte überhaupt erst wieder ins Gedächtnis gekommen. Sein nun erwecktes Gewissen marterte ihn, ließ ihm kaum Luft zum Atmen und doch beschloss er, nie und nimmer etwas von damals preiszugeben.
Dann kam die erste Beichte. Mit vorbereitetem Zettel begab er sich angstvoll hinter den dusteren Vorhang und leierte wie mit fremder Stimme das Gelernte herunter. Es war unheimlich und er vermied es nach dem Priester hinter dem Holzgitter zu schauen. Auch die ausdrückliche Frage des Pfaffen, ob er auch nichts vergessen habe, bestand er. Froh und erleichtert entkam er dem Halbdunkel, und während er die aufgegebene Buße abbetete, spürte er deutlich die befreiende Wirkung der Beichte, so wie der Pfarrer es immer gesagt hatte.
Zwei Tage später hatten sie wieder Religionsunterricht, und da geschah es. Kaum war das Gebet gesprochen, holte ihn der Pfarrer nach vorne. Er stellte ihn neben das Pult, machte zwei Schritte in die Klasse, drehte sich ruckartig um, zeigte