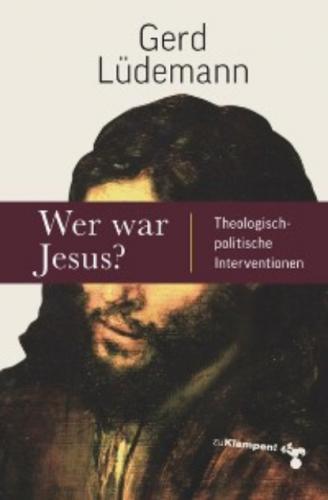Wie lange sich Jesus in der Umgebung des Täufers aufgehalten hat, bleibt unklar. Doch zeigt die in den Evangelien sichtbare Rivalität zwischen Jesus- und Johannesjüngern, dass Jesus schon bald nach seiner Taufe durch Johannes eigene Wege gegangen sein muss. Dieser Aufbruch war bei Jesus mit zweierlei verbunden: Ihm behagte auf Dauer die asketische Grundhaltung des Johannes nicht. Ferner entdeckte Jesus in sich die Fähigkeit, Besessene zu heilen. Dies wertete er gegenüber seinen Jüngern als untrüglichen Beweis dafür, dass unter ihnen das Reich Gottes, jene Verwirklichung der reinen Theokratie, vorab präsent sei. O-Ton Jesus: »Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen.«
Jesu Wunderkraft sprach sich in Galiläa bald herum. Die Exorzismen, durch die er psychisch Kranke gesund machte, sind die am besten bezeugten »Wunder« im Neuen Testament. Nerven- und Geisteskrankheiten wurden damals auf die Besessenheit von Dämonen zurückgeführt. Als Oberster dieser bösen Geister galt Satan. Ihn sah Jesus laut eigenem Zeugnis »wie einen Blitz aus dem Himmel fallen«. Damit war die Überwindung Satans, die fromme Juden erst von der Zukunft erwarteten, im Umkreis Jesu bereits gegenwärtige Realität. Jesus heilte Männer, Frauen, Kinder und entriss sie – mythologisch gesprochen – Satans Herrschaft, die keine mehr war.
Das Reich Gottes zeigte sich Jesus zufolge vorab nicht nur in seinen Heilungen – es schlug sich auch in Jesu Gewissheit nieder, am bald eintretenden Ende der Zeiten werde ein von ihm ausgewählter Zwölferkreis von Jüngern als Repräsentant des »wahren« Israel das übrige Israel richten. Diese Erwartung verband sich bei ihm aber nicht mit der Sicht, dass er als Messias oder Menschensohn der kommende Retter sei. Vielmehr ging es ihm darum, dem Reich Gottes den Weg zu bahnen.
Jesu Leben war in seiner entscheidenden Phase geprägt von dem felsenfesten Glauben, im Namen Gottes dessen Gesetz vollgültig auslegen zu müssen. Zu weiten Teilen war seine Thorainterpretation als Verschärfung des Willens Gottes wahrzunehmen. So verbot er die Ehescheidung mit Hinweis auf die gute Schöpfung Gottes, bei der Mann und Frau in der Ehe unwiderruflich ein Fleisch geworden seien. Das Liebesgebot spitzte er auf die Forderung der Feindesliebe zu. Das Schwören verbot er. Ab und zu reduzierte er die Thora und setzte dadurch die Speisegebote faktisch außer Kraft. Aber all das, was nach Autonomie aussah, war gegründet in Theonomie. Jesus konnte diese freien und gleichzeitig radikalen Interpretationen des Gesetzes nur durchführen, weil er meinte, dazu von Gott, den er liebevoll mit »Abba« (= Papa) anredete, die Vollmacht erhalten zu haben.
Exorzist, Gesetzesausleger und Zukunftsprophet war er, gleichzeitig aber auch Dichter und Weisheitslehrer. Jesus erzählte spannende Geschichten von Betrügern und sah in ihrer realistischen Einschätzung der jeweiligen Situation ein Vorbild für sich und seine eigenen Jünger. Das Leben Jesu in dieser Phase ähnelte dem eines unmoralischen Helden. Jesus arbeitete nicht mehr, was für einen jüdischen Lehrer untypisch war, und verlangte von seinen Jüngern, seinem Beispiel zu folgen. Er selbst ließ sich von seinen Verehrern aushalten.
In seine Erzählungen waren Klugheitsregeln eingebettet, die man eher von Philosophen erwartet hätte. In Gleichnissen veranschaulichte er, wie Gott sein Reich herbeiführen werde, nämlich leise und gleichzeitig doch unwiderruflich. Wieder andere Gleichnisse legen schlagend dar, dass Gott das Verlorene sucht. Jesus lieferte in seinem Leben den Kommentar dazu: Er war oft zu Gast bei Zöllnern und Huren. Manchmal bekamen seine Gleichnisse auch einen drohenden Klang: Im endzeitlichen Gericht, unmittelbar vor der Errichtung seines Reiches, vernichte Gott seine Feinde. Dann wende er das Schicksal der Armen, Hungernden und Weinenden zum Guten, zum heilvollen Vollendungszustand, wie die Seligpreisungen der Bergpredigt schlagend darlegen.
Jesus hatte in Galiläa Erfolg. Viele Menschen waren ihm zugetan. Nun zog es ihn nach Jerusalem, um Volk und Führung zur Umkehr aufzurufen. Als er offen Kritik an den im Tempel herrschenden Zuständen äußerte, hatte er in den Augen der jüdischen Führung die Tabugrenze überschritten. Was nun folgte, war nichts im Vergleich zu den Wortwechseln zwischen Jesus und seinen Kritikern in Galiläa. Die Jerusalemer Lokalaristokratie verleumdete Jesus – der doch von Gott allein die Errichtung seines Reiches in naher Zukunft erwartet hatte – als politischen König Israels. Damit war sein Schicksal besiegelt, und Pilatus machte kurzen Prozess. Aber auch Jesu Traum vom Reich Gottes erfüllte sich nicht, sein Leben endete im Fiasko am Kreuz.
An Stelle des Reiches Gottes aber kam die Kirche. Nicht lange nach dem Schock von Karfreitag behaupteten die engsten Jünger, sie hätten Jesus »gesehen«; dieser sei von den Toten erweckt worden und habe auf Petrus (= Stein) seine Kirche gegründet. Als auferstandener Gottessohn erteile er ihnen persönlich Weisungen. Fortan war nicht mehr das Kommen des Gottesreiches zentral; vielmehr rückten die Wiederkunft des auferstandenen Jesus und seine geheimnisvolle Gegenwart bei den Mahlfeiern in den Mittelpunkt. Urplötzlich beanspruchte Jesus Würdetitel, die er zu seinen Lebzeiten abgelehnt hatte: er nannte sich »Herr«, der allen Herren dieser Welt überlegen sei, »Menschensohn«, der auf den Wolken des Himmels zum Endgericht erscheine, »Gesalbter«, der zur Rechten Gottes sitze. Die dogmatische Lehre über Christus (»Christologie«), die alle Vollmachtsansprüche des historischen Jesus deutlich übertraf, war damit geboren. Sie rückte den historischen Jesus, der zwischen sich und Gott deutlich unterschieden hatte (»niemand ist gut außer einem einzigen, nämlich Gott«), in die Nähe Gottes, ja setzte beide gleich (»ich und der Vater sind eins«).
Wusste sich Jesus allein zu seinen jüdischen Zeitgenossen gesandt, so erweiterte sich das Blickfeld der Kirche rasch gewaltig. Zur aramäisch sprechenden Urkirche stießen bald griechischsprachige Juden – die den Mann aus Nazareth nicht einmal persönlich kannten – und trugen die christliche Botschaft zu den Heiden. Ihr berühmtester Schüler und einstiger Verfolger, der Expharisäer Paulus, »sah«, ebenso wie die engsten Jesusjünger vor ihm, den Auferstandenen und fühlte sich von diesem zum Apostel der Heiden berufen. Dieser jüdische Gelehrte gab der Heidenmission den entscheidenden Impuls, indem er sie im großen Stil organisierte und schrifttheologisch begründete. Motto: Die heilige Schrift Israels ist ein rein christliches Buch, die das Kommen Jesu und der Kirche im Voraus angekündigt hat.
War es schon eine Tragödie, dass der historische Jesus in Jerusalem einer politischen Intrige zum Opfer fiel, so gilt das gesteigert von der Art und Weise, wie die ersten Christen Jesu Predigt vom Gottesreich zur Lehre von der Gründung der Kirche durch den »Auferstandenen« verfälschten. Bis heute haben sie darin fromme Nachfolger gefunden.
5. Als Johannes der Täufer Karriere machte1
Johannes der Täufer stand in einer langen Reihe jüdischer Propheten, die zur Umkehr mahnten. Er verband die Bußforderung mit einer Taufe zur Vergebung der Sünden und der Ankündigung, dass nach ihm ein »Stärkerer« zum Gericht kommen werde. Für die Christen war dies Jesus, auf dessen Geburt Johannes nach den Evangelien verwies.
Als Wüstenbewohner trug der Täufer ein Kleid aus rauem Kamelhaar mit einem ledernen Gürtel. Damit erinnerte er an den Gottesmann Elia, dessen endzeitliche Wiederkunft viele Juden erwarteten. Johannes’ Auftreten knüpfte an prophetische Traditionen an, denen zufolge Israels zukünftiges Heil sich in der Wüste verwirklichen sollte. Massen strömten zu ihm an die Ostseite des Jordan, nahe der Einöde am Toten Meer. Auch Jesus von Nazareth und einige seiner späteren Jünger ließen sich taufen.
Das Wirken des Johannes begann demnach vor dem öffentlichen Auftreten Jesu (ca. 30 n. Chr.). Er überlebte seinen berühmtesten Täufling aber auch um etliche Jahre. So berichtet der jüdische Historiker Josephus von der Hinrichtung Johannes des Täufers durch seinen Landesherrn Herodes Antipas in der Festung Machärus östlich des Toten Meers – der Evangelist Markus setzt fälschlich die königliche Residenz in Tiberias in Galiläa als Ort der Exekution voraus – und fügt hinzu, laut jüdischer Volksmeinung habe Gott als