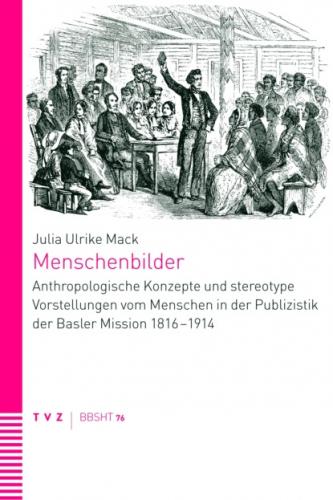a) Quellen
Die Untersuchung von Zeitschriften mit ihrer fortlaufenden Berichterstattung ist ein Gradmesser von Veränderungen und Umbrüchen. Sie ermöglicht das Aufzeigen von Kontinuitäten und Brüchen über einen längeren Zeitraum.
Die wissenschaftliche Erschließung des Evangelischen Missions-Magazins bezüglich seiner Geschichte, Redaktion, Autorenschaft und behandelten Themen stellt den Ausgangspunkt der Studie dar. Daran knüpft sich die Frage an nach dem Charakter und der Bedeutung von Missionszeitschriften im 19. Jahrhundert allgemein. |17|
Ältere Untersuchungen über die Zeitschrift liegen nicht vor. Sie wurde bis jetzt vor allem als Quelle für Einzeluntersuchungen, nicht aber in ihrer Funktion als historische Quelle bearbeitet.4
Untersucht werden die Jahrgänge 1816 bis 1914, also die Zeit von den Anfängen der Basler Mission bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, der für die Basler Mission als schweizerisch-württembergische Gesellschaft einschneidende Veränderungen mit sich brachte. In diese Zeit fällt die Gründung des deutschen Nationalstaates, das Einsetzen des Kolonialismus, die Ära der Hochindustrialisierung. Für die Basler Mission ist dieser Zeitraum unter anderem durch das Inspektorat des einflussreichen Inspektors Joseph Josenhans (1850–1879) geprägt. Dazu kommt 1874 die Gründung der Allgemeinen Missionszeitschrift (AMZ) von Gustav Warneck, durch die dem Basler Missions-Magazin eine gewichtige Konkurrenz erwuchs.5 Durch diesen großen Untersuchungszeitraum – 1816 bis zum Ende des ‹langen 19. Jahrhunderts› – lassen sich langfristige Entwicklungen in der Theologie und dem gesellschaftlichem Umfeld der Basler Mission aufzeigen. Die Dissertation bietet eine nötige – und bis dato fehlende – Grundlage für alle weiteren Untersuchungen zum Thema Menschenbilder in der Missionspublizistik.
Dem Missions-Magazin als Hauptquelle werden weitere Publikationen der Basler Mission zur Seite gestellt, daneben Zeitschriften anderer Missionsgesellschaften aus Deutschland und England, vornehmlich der Church Missionary Society, zu der die Basler Mission besonders enge Beziehungen hatte,6 sowie die bereits erwähnte Allgemeine Missionszeitschrift.
Da die anthropologischen Aussagen in den Artikeln des Missions-Magazins zwar zahlreich, aber durchwegs implizit vorhanden sind, sollen diese indirekt formulierten Aussagen durch explizit dogmatische Aussagen beispielsweise über «Der Mensch, das Haupt und der Zweck der sichtbaren Schöpfung» verbunden werden, wie sie in Die christliche Glaubenslehre (1876) von Friedrich Reiff, der als Lehrer am Missionshaus tätig war, zu finden sind.7 |18| Autoren aus dem Umfeld der Basler Mission mit spezifisch systematisch-theologischem Anliegen wie z.B. Hermann Gundert, Gustav Warneck und Theodor Oehler, die wie Reiff auch im Missions-Magazin publiziert, rezipiert und rezensiert wurden, bilden zusätzliche Referenzpunkte. Das erlaubt gleichzeitig einen Vergleich zwischen dem Sollen und dem Sein, zwischen der anthropologischen Lehre, mit der die Missionare ausgestattet wurden und ihre Arbeit begannen, und dem Menschenbild, welches aus den Aufsätzen und Artikeln des Missions-Magazins zur heimischen Leserschaft zurückkam. Welche Literatur von Angehörigen der Basler Mission rezipiert wurde, lässt sich anhand von Bibliothekskatalog und Verlagsführer nachvollziehen.8
Ein Problem der Quellen ist die redaktionelle Bearbeitung der Artikel. Die Missionare waren zu regelmäßigen Berichten an die Missionsleitung angehalten, die folglich als Grundlage für die publizierten Artikel dienten. Dabei muss stets beachtet werden, dass die Artikel immer zugleich auch als Werbetexte im Hinblick auf finanzielle und ideelle Unterstützung durch die Leserschaft dienen sollten. Von Interesse sind hier die sprachlichen Strategien, mit denen Plausibilität und Verbindlichkeit geschaffen und auf einen gemeinsamen Deutehorizont verwiesen wurde, um den Zusammenhang zwischen Autoren- und Leserschaft zu stärken.9
Und schließlich sind noch die zahlreichen Traktate zu nennen, die seit Bestehen der Basler Missionsgesellschaft zu vielen unterschiedlichen Themen erschienen und oft mehr als zehn Auflagen erreichten. Da sie sich oft mit den gleichen Themen beschäftigten, die auch die Zeitschriften behandelten, dies aber zumeist in einer viel plakativeren, polemischeren Sprache, sind sie punktuell eine interessante Ergänzung zu den Artikeln und können bestimmte Positionen auf besonders prägnante Weise illustrieren.
b) Methoden
Die Sichtung der Jahrgänge des Missions-Magazins und das Erstellen einer Übersicht der behandelten Themen geschehen mit Hilfe einer syntaktischen Analyse. Systematisch-theologische Abhandlungen und Charakterisierungen von Menschen, Rassen, Ländern werden genauer untersucht.
Die Annäherung an die ausgesuchten Texte geschieht mit dem Instrumentarium der medienwissenschaftlichen Inhaltsanalyse.10 Der Schwerpunkt der Analysen liegt auf der semantischen und der pragmatischen Ebene. |19| Schlüsselbegriffe wie ‹wild›, ‹Mann – Frau›, ‹heidnisch – bekehrt – christlich›, ‹Erziehung – Kultur›, ‹schwarz – weiß›, ‹der alte› bzw. ‹der neue Mensch›, werden quantitativ und qualitativ erfasst: Die in den Texten behandelten Themen und Motive werden zusammengefasst und in Kategorien aufgeteilt. In einer vergleichenden Themenanalyse wird untersucht, wie häufig und in welchem Zusammenhang die (semantischen) Kategorien in den Publikationsorganen auftauchen.
Die textpragmatisch orientierte Wert- bzw. Einstellungsanalyse untersucht die vom Autor vertretenen Werte und Einstellungen, die Motivanalyse beschäftigt sich mit der Aussagemotivation des Kommunikators/Autors.11
C. Inhaltliche Untersuchung
Die in der Inhaltsanalyse gewonnenen Ergebnisse fließen in die anschließende Interpretation ein. Die Interpretation selbst steht in der geisteswissenschaftlichen Tradition und bietet einen hermeneutischen Zugang. So wird es durch das Hinzuziehen textimmanenter und -externer Fakten möglich, die Bedeutungsstrukturen der Texte verstehend nachzuvollziehen. Dabei wird der hermeneutische Zirkel, in dem sich jede Untersuchung bewegt, immer mitreflektiert.
Die Untersuchung von Auto- und Heterostereotypen, ihre Interdependenz und Interaktion sowie ihre geschichtlichen und sprachlichen Erscheinungsformen in den Schriften der Basler Mission soll durch die Erforschung der theologischen Anthropologie vertieft und ergänzt werden. Sie werden von den Akteuren, den Autoren der Missionspublikationen, her interpretiert. Dies ermöglicht einerseits eine multiperspektivische und kritische Annäherung, andererseits sollen den heutigen Leserinnen und Lesern die damaligen Menschenbilder nahe gebracht werden. So bekommen sie einen Zugang zu der ‹fremden› Missionsgesellschaft als Ganze.12 Leitend ist dabei das theologisch-historische Interesse an der Missionsgeschichte des 19. Jahrhunderts.13 |20|
|23|
1. Einleitung
«Was muss heutzutage nicht alles der Mission dienen? Da gibt es Missionsreiseprediger und Missionsärzte, Missionslehrer und Missionskaufleute, Missionskolonisten und Missionshandwerker, Missionsstationen und Missionsschulen, Missionsspitäler und Missionsdruckereien, Missionsschiffe und Missionskarawanen, Missionszelte und Missions- wer weiß was noch. Da wird gepredigt auf Straßen und Märkten, bei Götzenfesten und in Tempeln, in Häusern und auf freiem Feld – aber gepredigt nicht nur durchs Wort, sondern gepredigt auch durch Bilder, durch Inschriften, ja durch Zauberlaternen und Schattenspiele […]. Da wird studiert und übersetzt, geschrieben und gedruckt, redigiert und kolportiert.»14
Mit diesen Worten beschrieb Johannes Hesse im Jahr 1900 in einem Rückblick auf das ‹Missionsjahrhundert› die Mittel und Methoden der Missionsgesellschaften. Er ist ein Zeuge für die enorme Ausdifferenzierung, die sich seit den Anfängen der systematischen protestantischen Mission vollzogen hatte und für die zentrale Stellung, welche die literarische Arbeit – das Studieren, Übersetzen, Schreiben, Drucken, Redigieren und Kolportieren – in den Missionen einnahm.
Das folgende Kapitel charakterisiert nach einem Überblick über den Stand der Forschung (2.1.) das Medium der Missionszeitschrift (2.2.) und untersucht den historischen Wert ihrer Illustrationen (2.3.) sowie die Bedeutung und Beschränkungen, die ihr als Quelle kirchengeschichtlicher Forschung zukommt (2.4.).
Das 3. Kapitel beschäftigt sich mit dem Kontext, in dem die