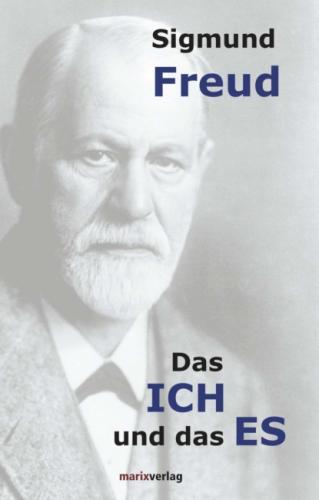Die Einleitung der Behandlung mit einer solchen für einige Wochen angesetzten Probezeit hat übrigens auch eine diagnostische Motivierung. Oft genug, wenn man eine Neurose mit hysterischen oder Zwangssymptomen vor sich hat, von nicht exzessiver Ausprägung und von kürzerem Bestande, also gerade solche Formen, die man als günstig für die Behandlung ansehen wollte, muss man dem Zweifel Raum geben, ob der Fall nicht einem Vorstadium, einer sogenannten Dementia praecox (Schizophrenie nach Bleuler, Paraphrenie nach meinem Vorschlag) entspricht und nach kürzerer oder längerer Zeit ein ausgesprochenes Bild dieser Affektion zeigen wird. Ich bestreite es, dass es immer so leicht möglich ist, die Unterscheidung zu treffen. Ich weiß, dass es Psychiater gibt, die in der Differentialdiagnose seltener schwanken, aber ich habe mich überzeugt, dass sie ebenso häufig irren. Der Irrtum ist nur für den Psychoanalytiker verhängnisvoller als für den sogenannten klinischen Psychiater. Denn der Letztere unternimmt in dem einen Falle so wenig wie in dem anderen etwas Ersprießliches; er läuft nur die Gefahr eines theoretischen Irrtums, und seine Diagnose hat nur akademisches Interesse. Der Psychoanalytiker hat aber im ungünstigen Falle einen praktischen Missgriff begangen, er hat einen vergeblichen Aufwand verschuldet und sein Heilverfahren diskreditiert. Er kann sein Heilungsversprechen nicht halten, wenn der Kranke nicht an Hysterie oder Zwangsneurose, sondern an Paraphrenie leidet, und hat darum besonders starke Motive, den diagnostischen Irrtum zu vermeiden. In einer Probebehandlung von einigen Wochen wird er oft verdächtige Wahrnehmungen machen, die ihn bestimmen können, den Versuch nicht weiter fortzusetzen. Ich kann leider nicht behaupten, dass ein solcher Versuch regelmäßig eine sichere Entscheidung ermöglicht; es ist nur eine gute Vorsicht mehr.2
Lange Vorbesprechungen vor Beginn der analytischen Behandlung, eine andersartige Therapie vorher, sowie frühere Bekanntschaft zwischen dem Arzte und dem zu Analysierenden haben bestimmte ungünstige Folgen, auf die man vorbereitet sein muss. Sie machen nämlich, dass der Patient dem Arzt in einer fertigen Übertragungseinstellung gegenübertritt, die der Arzt erst langsam aufdecken muss, anstatt dass er die Gelegenheit hat, das Wachsen und Werden der Übertragung von Anfang an zu beobachten. Der Patient hat so eine Zeitlang einen Vorsprung, den man ihm in der Kur nur ungern gönnt.
Gegen alle die, welche die Kur mit einem Aufschub beginnen wollen, sei man misstrauisch. Die Erfahrung zeigt, dass sie nach Ablauf der vereinbarten Frist nicht eintreffen, auch wenn die Motivierung dieses Aufschubes, also die Rationalisierung des Vorsatzes, dem Uneingeweihten tadellos erscheint.
Besondere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn zwischen dem Arzt und dem in die Analyse eintretenden Patienten oder deren Familien freundschaftliche oder gesellschaftliche Beziehungen bestanden haben. Der Psychoanalytiker, von dem verlangt wird, dass er die Ehefrau oder das Kind eines Freundes in Behandlung nehme, darf sich darauf vorbereiten, dass ihn das Unternehmen, wie immer es ausgehe, die Freundschaft kosten wird. Er muss doch das Opfer bringen, wenn er nicht einen vertrauenswürdigen Vertreter stellen kann.
Laien wie Ärzte, welche die Psychoanalyse immer noch gern mit einer Suggestivbehandlung verwechseln, pflegen hohen Wert auf die Erwartung zu legen, welche der Patient der neuen Behandlung entgegenbringt. Sie meinen oft, mit dem einen Kranken werde man nicht viel Mühe haben, denn er habe ein großes Zutrauen zur Psychoanalyse und sei von ihrer Wahrheit und ihrer Leistungsfähigkeit voll überzeugt. Bei einem anderen werde es wohl schwerer gehen, denn er verhalte sich skeptisch und wolle nichts glauben, ehe er nicht den Erfolg an seiner eigenen Person gesehen habe. In Wirklichkeit hat aber diese Einstellung der Kranken eine recht geringe Bedeutung; sein vorläufiges Zutrauen oder Misstrauen kommt gegen die inneren Widerstände, welche die Neurose verankern, kaum in Betracht. Die Vertrauensseligkeit des Patienten macht ja den ersten Verkehr mit ihm recht angenehm; man dankt ihm für sie, bereitet ihn aber darauf vor, dass seine günstige Voreingenommenheit an der ersten in der Behandlung auftauchenden Schwierigkeit zerschellen wird. Dem Skeptiker sagt man, dass die Analyse kein Vertrauen braucht, dass er so kritisch und misstrauisch sein dürfe, als ihm beliebt, dass man seine Einstellung gar nicht auf die Rechnung seines Urteiles setzen wolle, denn er sei ja nicht in der Lage, sich ein verlässliches Urteil über diese Punkte zu bilden; sein Misstrauen sei eben ein Symptom wie seine anderen Symptome, und es werde sich nicht als störend erweisen, wenn er nur gewissenhaft befolgen wolle, was die Regel der Behandlung von ihm fordere.
Wer mit dem Wesen der Neurose vertraut ist, wird nicht erstaunt sein zu hören, dass auch derjenige, der sehr wohl befähigt ist, die Psychoanalyse an anderen auszuüben, sich benehmen kann wie ein anderer Sterblicher und die intensivsten Widerstände zu produzieren imstande ist, sobald er selbst zum Objekte der Psychoanalyse gemacht wird. Man bekommt dann wieder einmal den Eindruck der psychischen Tiefendimension und findet nichts Überraschendes daran, dass die Neurose in psychischen Schichten wurzelt, bis zu denen die analytische Bildung nicht hinabgedrungen ist.
Wichtige Punkte zu Beginn der analytischen Kur sind die Bestimmungen über Zeit und Geld.
In Betreff der Zeit befolge ich ausschließlich das Prinzip des Vermietens einer bestimmten Stunde. Jeder Patient erhält eine gewisse Stunde meines verfügbaren Arbeitstages zugewiesen; sie ist die seine und er bleibt für sie haftbar, auch wenn er sie nicht benützt. Diese Bestimmung, die für den Musik- oder Sprachlehrer in unserer guten Gesellschaft als selbstverständlich gilt, erscheint beim Arzt vielleicht hart oder selbst standesunwürdig. Man wird geneigt sein, auf die vielen Zufälligkeiten hinzuweisen, die den Patienten hindern mögen, jedes Mal zu derselben Stunde beim Arzt zu erscheinen, und wird verlangen, dass den zahlreichen interkurrenten Erkrankungen Rechnung getragen werde, die im Verlauf einer längeren analytischen Behandlung vorfallen können. Allein meine Antwort ist: Es geht nicht anders. Bei milderer Praxis häufen sich die »gelegentlichen« Absagen so sehr, dass der Arzt seine materielle Existenz gefährdet findet. Bei strenger Einhaltung dieser Bestimmung stellt sich dagegen heraus, dass hinderliche Zufälligkeiten überhaupt nicht vorkommen und interkurrente Erkrankungen nur sehr selten. Man kommt kaum je in die Lage, eine Muße zu genießen, deren man sich als Erwerbender zu schämen hätte; man kann die Arbeit ungestört fortsetzen und entgeht der peinlichen, verwirrenden Erfahrung, dass gerade dann immer eine unverschuldete Pause in der Arbeit eintreten muss, wenn sie besonders wichtig und inhaltsreich zu werden versprach. Von der Bedeutung der Psychogenie im täglichen Leben der Menschen, von der Häufigkeit der »Schulkrankheiten« und der Nichtigkeit des Zufalls gewinnt man erst eine ordentliche Überzeugung, wenn man einige Jahre hindurch Psychoanalyse betrieben hat unter strenger Befolgung des Prinzips der Stundenmiete. Bei unzweifelhaften organischen Affektionen, die durch das psychische Interesse doch nicht ausgeschlossen werden können, unterbreche ich die Behandlung, halte mich für berechtigt, die frei gewordene Stunde anders zu vergeben, und nehme den Patienten wieder auf, sobald er hergestellt ist und ich eine andere Stunde frei bekommen habe.
Ich arbeite mit meinen Patienten täglich mit Ausnahme der Sonntage und der großen Festtage, also für gewöhnlich sechsmal in der Woche. Für leichte Fälle oder Fortsetzungen von weit gediehenen Behandlungen reichen auch drei Stunden wöchentlich aus. Sonst bringen Einschränkungen an Zeit weder dem Arzt noch dem Patienten Vorteil; für den Anfang sind sie ganz zu verwerfen. Schon durch kurze Unterbrechungen wird die Arbeit immer ein wenig verschüttet; wir pflegten scherzhaft von einer »Montagskruste« zu sprechen, wenn wir nach der Sonntagsruhe von Neuem begannen; bei seltener Arbeit besteht die Gefahr, dass man mit dem realen Erleben des Patienten nicht Schritt halten kann, dass die Kur den Kontakt mit der Gegenwart verliert und auf Seitenwege gedrängt wird.