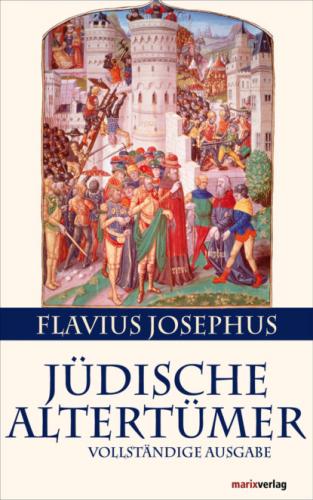Möge die vorliegende Ausgabe eine Anregung sein zu weiteren fruchtbringenden Studien über den Schriftsteller Josephus, zu dessen vollem Verständnis noch manches zu tun übrig bleibt. »Die Philologen«, sagt Paret, »pflegen ihn als einen der Theologie angehörigen Schriftsteller zu betrachten, die Theologen umgekehrt als einen solchen, der sie nicht direkt angehe. So kam es, dass er vernachlässigt und nicht so häufig zum Gegenstande von Spezialstudien gemacht wurde, wie er wohl verdienen würde. Wie zu seinen Lebzeiten, so hat er, kann man sagen, auch jetzt noch unter seiner Zwitterstellung zwischen Jerusalem und Rom zu leiden.«
Die Übersetzung habe ich angefertigt nach der Textausgabe von Dindorf (Paris, Didot 1865) unter vergleichsweiser Heranziehung der alten, aber sehr schönen kritischen Ausgabe von Havercamp (Amsterdam 1726). Die den einzelnen Büchern vorausgeschickten Inhaltsübersichten folgen der Dindorf’schen Ausgabe, während die Überschriften der einzelnen Kapitel sich im Allgemeinen an die Kapitelüberschriften der Havercamp’schen Ausgabe anlehnen (der Dindorf’sche Text weist keine Kapitelüberschriften auf). Für den Gebrauch der Übersetzung glaube ich darauf hinweisen zu müssen, dass die einzelnen Nummern der Inhaltsübersichten nicht den Kapitelüberschriften entsprechen.
Bei den Eigennamen habe ich die Schreibweise des Josephus durchgängig beibehalten und an den wenigen Stellen, wo die Namen allzu sehr von der uns geläufigen biblischen Schreibweise abweichen, erklärende Anmerkungen zugefügt. Dass die speziell römischen Namen in der lateinischen und nicht in der griechischen Form aufgeführt sind, versteht sich ja von selbst.
Zum genussreichen Studium der Werke des Josephus, insbesondere der »Altertümer« und des »Jüdischen Krieges«, bedarf es auch einiger geographischen Hilfsmittel, und zwar können zu diesem Zwecke schon alle guten Atlanten dienen, die Karten von Palästina zur Zeit der Einteilung in die zwölf Stämme und zur Zeit Christi enthalten. Gründlichere Belehrung bieten die besonderen Bibelatlanten, unter denen ich den von Riess (Freiburg, Herder) namentlich empfehlen möchte. Die Palästina-Karte des Andree’-schen Handatlas weist den Vorzug auf, dass sie die neuen wie die alten Ortsbezeichnungen gleichzeitig bringt. Immerhin bleibt zu bedauern, dass nicht ein spezieller Atlas zu den Werken des Josephus seinen Bearbeiter gefunden hat, und es bedarf vielleicht nur dieser Anregung, um eine geeignete Kraft zur Herausgabe eines solchen Atlas zu veranlassen.
Weitere Hilfsmittel bei der Lektüre des Josephus bieten gute Reise- und geographisch-geschichtliche Werke über Palästina, wie die von Bädeker-Socin, Robinson, v. Raumer und Schwarz. Nicht übergehen will ich endlich das mit großem Fleiße bearbeitete »topographisch-historische Lexikon zu den Schriften des Flavius Josephus« von Gustav Böttger, dem auch die geographischen Bemerkungen des dieser Übersetzung beigefügten Namenregisters entstammen. Diese Bemerkungen sind von mir absichtlich in dem Register untergebracht worden, um den eigentlichen Text nicht zu sehr mit Anmerkungen zu überlasten.
Die Zeichnungen zu den Illustrationen mit Ausnahme des Herodianischen Tempels sind von meinem Neffen, dem Architekten Joseph Lauff zu Köln, nach meinen Angaben und unter teilweiser Anlehnung an Abbildungen des Neumann’schen Werkes »die Stiftshütte«, deren Benutzung der Verleger Friedrich Andreas Perthes zu Gotha mit dankenswerter Bereitwilligkeit gestattete, angefertigt worden. Maßgebend war dabei hauptsächlich der Gesichtspunkt, dass die Bilder der Schilderung des Josephus möglichst getreu entsprechen müssten. Demzufolge ist z. B. beim Brandopferaltar das viel umstrittene »netzförmige Flechtwerk« als Rost des Altares zwischen die Hörner desselben gelegt worden, da die klare Darstellung unseres Schriftstellers keine andere Deutung zulässt; ebenso sind die Cherubim auf der heiligen Lade, die Josephus »geflügelte Tiere« nennt, unter Anlehnung an die altassyrischen Kherubsgestalten als geflügelte Mischwesen von Mensch und Stier aufgefasst worden, wie das auch Neumann in dem zitierten Werke getan hat.
Von den beiden Stammbäumen der Asmonäer und Herodianer hoffe ich, dass sie das Verständnis der betreffenden Stellen des Werkes erheblich fördern werden; namentlich bei den etwas verwickelten Verhältnissen der Familie des Herodes ist eine solche geordnete Übersicht kaum zu entbehren.
Zum Schlusse versichere ich, dass die Übersetzung durchaus wortgetreu und vollständig ist. Ob sie auch die dritte Bedingung einer guten Übersetzung erfüllt, nämlich möglichst wohllautend zu sein, das zu beurteilen, überlasse ich dem geneigten Leser.
Dr. Heinrich Clementz.
ERSTES BUCH
DIESES BUCH UMFASST EINEN ZEITRAUM
VON 3833 JAHREN
VORWORT
1. Diejenigen, welche sich der Geschichtschreibung befleißigen, tun dies nicht aus ein und denselben, sondern aus vielfachen, meist unter sich verschiedenen Beweggründen. Denn einige gehen an diese Art Arbeit, um ihre Redegewandtheit leuchten zu lassen und dadurch berühmt zu werden, andere, um denen zu gefallen, über die sie schreiben. Freilich trauen sich diese Letzteren oft mehr zu, als sie vermögen. Wieder andere treibt ein gewisser Zwang, die Ereignisse, deren Zeugen sie waren, schriftlich vor Vergessenheit zu bewahren; viele auch veranlasst die Erhabenheit wichtiger, im Dunkel verborgener Tatsachen, diese zum allgemeinen Besten zu erzählen. Von den genannten Beweggründen sind für mich die zwei letzten in Betracht gekommen. Denn den Krieg zu beschreiben, den wir Juden mit den Römern geführt haben, dazu war ich als Mitkämpfer gewissermaßen gezwungen, um diejenigen zu widerlegen, welche in ihren Schriften Falsches darüber berichtet haben.
2. Das vorliegende Werk dagegen nahm ich in Angriff, weil ich allen Griechen damit etwas Bedeutendes bieten zu können glaubte. Es wird nämlich unsere ganze Altertumskunde und die Verfassung unseres Staates enthalten, wie ich sie aus hebräischen Schriften (ins Griechische) übertragen habe. Schon früher, als ich die Geschichte des Krieges schrieb, gedachte ich auch kundzugeben den Ursprung der Juden, ihre mannigfaltigen Schicksale, wie sie unter einem großen Gesetzgeber die Verehrung Gottes und alle übrigen Tugenden kennen lernten, welche Kriege sie im Laufe der Zeiten geführt und wie sie endlich wider ihren Willen zum letzten Kriege gegen die Römer gedrängt wurden. Doch der zu große Umfang des Stoffes nötigte mich, die Geschicke der Juden vor dem Kriege mit den Römern von Anfang an bis zu diesem Zeitpunkte besonders zu beschreiben. Aber im Laufe der Zeit beschlich mich, da ich mich unterfangen, einen so gewaltigen Stoff in einer fremden, ungewohnten Sprache wiederzugeben, oft eine gewisse Trägheit, wie es denen gewöhnlich ergeht, die allzu Schwieriges unternehmen. Indes ermunterten mich viele, das Werk fortzusetzen, in erster Reihe Epaphroditus, ein Mann, der allen Wissenschaften und besonders der Geschichte sehr zugetan war, zumal er selbst große Ereignisse und mancherlei Schicksale erlebt hatte, wobei er stets eine geistig hervorragende Natur und unerschütterte Wahrheitsliebe offenbarte. Diesem hochherzigen Gönner aller nützlichen und ehrbaren Bestrebungen gegenüber schämte ich mich, den Anschein zu erwecken, als ob ich den Müßiggang fleißiger Arbeit vorzöge, und ich nahm daher alle meine Geisteskräfte zusammen. Dazu kam noch, dass ich immer und immer wieder erwog, wie gern unsere Vorfahren ihre Geschichte den Fremden mitzuteilen geneigt waren, und wie manche Griechen vor Eifer brannten, unsere Schicksale kennen zu lernen.
3. Ich erfuhr besonders, dass der König Ptolemäus II., wie er überhaupt den Wissenschaften und dem Bibliothekswesen sehr zugetan war, danach verlangte, unsere Gesetze und die Bestimmungen unserer Staatsverfassung ins Griechische übertragen zu sehen, und dass Eleazar, der an Tugend keinem unserer Hohepriester nachstand, keinen Anstand nahm, dem Könige den Gebrauch derselben zu gestatten, den er doch gewiss verweigert haben würde, wenn es nicht bei uns alte Sitte gewesen wäre, Gutes und Anständiges vor niemand geheim zu halten. Daher glaubte ich, dass es auch mir wohl anstehe, die Großmut unseres Hohepriesters nachzuahmen, umso mehr, als ich überzeugt bin,