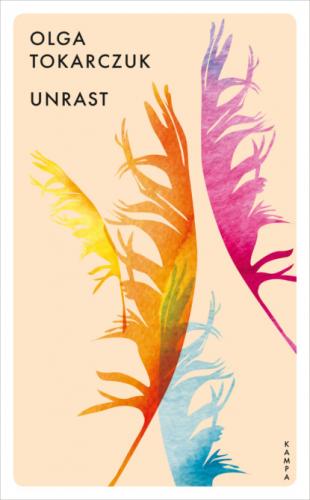Sie hatten recht, die behaupteten, diese Fachrichtung suche man sich nicht im Hinblick auf einen zukünftigen Beruf, aus Interesse, aus dem Wunsch heraus, anderen zu helfen, oder ähnlichen schlichten Gründen. Ich habe den Verdacht, dass wir alle einen tief im Innern verborgenen Defekt hatten, obwohl wir bestimmt wie intelligente, gesunde junge Leute wirkten. Es war ein maskierter Defekt, der bei der Aufnahmeprüfung geschickt getarnt wurde. Ein heillos verheddertes, verfilztes Emotionsknäuel, wie die seltsamen Geschwulste, die man manchmal im menschlichen Körper entdeckt und in jedem Anatomie- und Pathologiemuseum findet, das etwas auf sich hält. Aber vielleicht waren unsere Prüfer ja vom gleichen Schlag und wussten in Wirklichkeit genau, was sie taten. Dann wären wir sozusagen ihre Erben gewesen.
Als wir im zweiten Jahr die Funktion von Schutzmechanismen behandelten und verwundert die Macht dieses Teils unserer Psyche erkannten, verstanden wir allmählich eines: Wenn wir keine Rationalisierung, Sublimierung, Verdrängung, keines dieser Kunststückchen hätten, derer wir uns bedienen, wenn wir ganz schutzlos, ehrlich und mutig die Welt betrachten würden – dann würde es uns das Herz brechen.
Was wir in diesem Studium lernten, war, dass wir aus Schutzvorrichtungen bestehen, aus Schild und Rüstung, wir sind Städte, deren Architektur aus Mauern, Basteien und Befestigungen besteht, wir sind Bunkerstaaten.
Alle Tests, Interviews und Untersuchungen führten wir aneinander durch, und nach dem dritten Studienjahr konnte ich mein Problem schon benennen, das war wie die Entdeckung eines geheimen Eigennamens, mit dem man zu einer Initiation aufgerufen wird.
In meinem erlernten Beruf hielt es mich nicht lange. Während einer meiner Reisen, als ich ohne Geld in einer großen Stadt festsaß und als Zimmermädchen arbeitete, begann ich zu schreiben. Es war eine Geschichte für die Reise, zum Lesen im Zug, etwas, was ich für mich selbst schreiben würde. Ein Buch wie ein Häppchen, das man ganz herunterschluckt, ohne abzubeißen.
Ich konnte mich entsprechend konzentrieren, für eine gewisse Zeit wurde ich zu einem ungeheuerlichen Ohr, das auf Geräusche, Echos und Geflüster lauschte, auf ferne Stimmen, die hinter einer Wand erklangen.
Doch nie wurde ich eine richtige Schriftstellerin oder – besser gesagt – ein Schriftsteller, denn in diesem Genus hört sich das Wort ernsthafter an. Das Leben entwischte mir immer wieder. Ich stieß immer nur auf seine Spuren, auf erbärmliche abgestreifte Häute. Wenn ich seine Position anpeilte, war es schon wieder woanders. Ich fand nur Zeichen, wie diese eingeritzten Inschriften in der Rinde von Parkbäumen: Ich war hier. In meinem Schreiben wurde das Leben zu unvollständigen Erzählungen, traumgleichen kleinen Geschichten mit ausfransenden Erzählfäden, von weitem erschien es in ungewöhnlich verschobenen Perspektiven oder wie ein Querschnitt – und es ließen sich kaum Schlussfolgerungen auf das Ganze ziehen.
Jeder, der schon einmal versucht hat, einen Roman zu schreiben, weiß, was das für ein mühsames Unterfangen ist, es ist zweifellos eine besonders schlechte Form der Selbstbeschäftigung. Die ganze Zeit muss man in sich selbst sein, in einer Einpersonenzelle, in völliger Einsamkeit. Es ist eine kontrollierte Psychose, eine Paranoia und zugleich Obsession, die mit Arbeit verbunden ist und deshalb auch nicht mit den Federn, Rüschen und venezianischen Masken ausgestattet, die wir damit assoziieren, sondern eher mit Fleischerschürze und Gummistiefeln und einem Messer zum Ausweiden in der Hand. Aus diesem Schriftstellerkeller sieht man allenfalls die Beine der Passanten, hört das Klappern der Absätze. Manchmal bleibt einer stehen, bückt sich und wirft einen Blick hinein, dann bekommt man ein menschliches Gesicht zu sehen und kann sogar ein paar Worte wechseln. Doch in Wirklichkeit ist der Geist mit seinem Spiel beschäftigt, das in einem hastig skizzierten Panoptikum abläuft, er stellt die Figuren auf einer provisorischen Bühne zurecht: Autor und Held, Erzählerin und Leserin, den, der beschreibt, und diejenige, die beschrieben wird; Füße, Schuhe, Absätze und Gesichter werden früher oder später ein Teil dieses Spiels.
Es tut mir nicht leid, dass ich mir just diese Tätigkeit ausgesucht habe. Zum Psychologen hätte ich nicht getaugt. Ich konnte keine Erklärungen finden, konnte in den Dunkelkammern des Geistes keine Familienfotos entwickeln. Die Bekenntnisse anderer haben mich oft gelangweilt, wie ich betrübt eingestehen muss. Ehrlich gesagt kam es öfter vor, dass ich gern die Rollen getauscht und ihnen von mir erzählt hätte. Ich musste mich vorsehen, dass ich nicht unvermittelt eine Patientin am Ärmel fasste und sie mitten im Satz unterbrach. »Was Sie nicht sagen! Das empfinde ich ganz anders! Wenn Sie wüssten, was ich geträumt habe! Hören Sie zu …« Oder: »Was wissen Sie schon von Schlaflosigkeit, guter Mann! Das soll eine Panikattacke sein? Dass ich nicht lache! Der Patient vor ihnen, der hat vielleicht …«
Ich konnte nicht zuhören. Ich wahrte nicht die Grenzen, war anfällig für Übertragungen. Ich glaubte nicht an Statistiken, nicht an die Verifizierbarkeit von Theorien. Die Prämisse der Deckungsgleichheit von Persönlichkeit und Mensch kam mir immer zu minimalistisch vor. Ich neigte dazu, das Offensichtliche zu verschleiern, felsenfeste Argumente in Zweifel zu ziehen, es war eine Angewohnheit, perverses Yoga des Hirns, ein subtiler Genuss beim Verspüren innerer Bewegung. Urteile betrachtete ich mit Skepsis, schmeckte sie unter der Zunge und machte die keineswegs überraschende Entdeckung, dass keines echt war, dass alles künstlich war, gefälschte Marken. Ich wollte keine festen Überzeugungen, sie wären unnötiger Ballast für mich gewesen. In Diskussionen stand ich mal auf dieser, mal auf jener Seite, ich weiß, dass mich das bei meinen Gesprächspartnern nicht beliebt machte. Ich war Zeuge eines merkwürdigen Vorgangs in meinem Kopf: Je mehr Argumente ich »für« etwas fand, desto mehr fielen mir »dagegen« ein, und je stärker ich an den ersteren hing, desto mehr drängten sich die letzteren auf.
Wie sollte ich andere untersuchen können, wenn mir selbst schon jeder Test so schwerfiel. Persönlichkeitstest, Umfragen, Fragebögen mit Kolonnen von Fragen und Skalen zum Ankreuzen der Antwort kamen mir zu schwierig vor. Diese Unzulänglichkeit wurde mir bald bewusst, und wenn wir uns in den praktischen Übungen während des Studiums gegenseitig befragen mussten, gab ich meine Antworten auf gut Glück. Ein seltsames Profil kam dabei heraus, eine schiefe Kurve im Koordinatennetz. »Glaubst du, dass die beste Entscheidung immer die ist, die sich am leichtesten ändern lässt?« Ob ich glaube? Was für eine Entscheidung? Ändern? Wann? Und was heißt leicht? »Du betrittst einen Raum – nimmst du eher einen Platz in der Mitte oder am Rand ein?« Was für ein Raum? Und wann? Ist der Raum leer, oder stehen rote Plüschsofas an der Wand? Und die Fenster – wie ist der Ausblick? Und was Bücher angeht: Lese ich lieber das Buch, anstatt auf eine Party zu gehen, oder hängt es vom Buch und von der Party ab?
Was für eine Methodologie! Stillschweigend geht man davon aus, dass der Mensch sich selbst nicht kennt, doch, mit so schlauen Fragen konfrontiert, sich selbst ausspionieren wird. Er selbst stellt sich die Frage, er selbst gibt die Antwort. Und unversehens verrät er sich selbst gegenüber ein Geheimnis, von dem er nichts gewusst hat.
Und die zweite lebensgefährliche Annahme ist die, dass wir statisch und unsere Reaktionen berechenbar sind.
Das Syndrom
Die Geschichte meiner Reisen ist nur die Geschichte einer Unzulänglichkeit. Ich leide an einem Syndrom, das sich mühelos in jedem Atlas klinischer Syndrome finden lässt und das – wie die Fachliteratur behauptet – immer mehr um sich greift. Am besten greift man zu »The Clinical Syndrome« in einer älteren Ausgabe, aus den siebziger Jahren. Das ist eine Art eigener Syndrom-Enzyklopädie. Für mich übrigens eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Würde es da noch jemand wagen, den Menschen als Ganzes zu beschreiben, allgemein und objektiv? Sich voller Überzeugung des Begriffs der »Persönlichkeit« zu bedienen? Begeisterung für eine überzeugende Typologie aufzubringen? Ich glaube kaum. Der Begriff des Syndroms passt wie angegossen auf die Reisepsychologie. Ein Syndrom ist nicht groß, übertragbar, an keine schlaffe Theorie gebunden, episodisch. Man kann damit etwas erklären und es dann in den Papierkorb werfen. Ein Erkenntniswerkzeug zum Einmalgebrauch. Meines heißt Perseveratives Detoxifikationssyndrom. Ganz nüchtern und schlicht erklärt, bedeutet es nur so viel, dass es dem Wesen nach auf der hartnäckigen Bewusstmachung bestimmter Vorstellungen, ja sogar auf der zwanghaften Suche nach diesen Vorstellungen beruht. Es ist eine Variante des »Mean World Syndrome« (»Böse-Welt-Syndrom«),