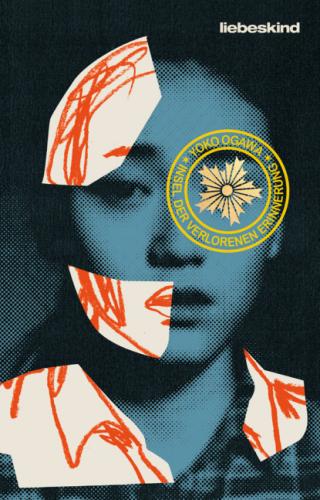Ich dachte, dass diese Aktion weitaus einfacher durchzuführen war als jene, bei der ein Spezialkommando meine Mutter verschleppt hatte. Da die Männer nun alles, was ihnen verdächtig vorgekommen war, in die Plastiksäcke gestopft hatten, würden sie wohl nicht wiederkommen. Durch den Tod meines Vaters wäre die im Haus schwebende Erinnerung an die Vögel ohnehin nach und nach verblasst.
Die ganze Aktion hatte nur eine Stunde gedauert und zehn volle Plastiksäcke ergeben. Die Morgensonne schien ins Büro und hatte den Raum merklich aufgeheizt. Am Kragen der Männer funkelten die blank polierten Abzeichen, aber kein Einziger von ihnen geriet außer Atem oder vergoss einen Tropfen Schweiß.
Jeder warf sich mühelos zwei Säcke über die Schulter und brachte sie zu einem Lastwagen, den sie draußen vor dem Haus geparkt hatten.
Nach nur einer Stunde hatte sich das Zimmer völlig verändert. Die Spuren meines Vaters, die ich so sorgsam zu bewahren versucht hatte, waren wie ausgelöscht. Stattdessen herrschte eine Leere, die nicht mehr auszufüllen war. Und inmitten dieser Leere stand ich. Sie war wie ein tiefer Abgrund, der mich zu verschlingen drohte.
3
Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit Schreiben. Bisher habe ich drei Bücher veröffentlicht. Mein erster Roman handelt von einem Klavierstimmer, der durch Musikalienhandlungen und Konzertsäle irrt, um nach seiner verschwundenen Geliebten, einer Pianistin, zu suchen, wobei er sich allein auf die von ihr gespielten Töne verlässt, die noch in seinen Ohren klingen. Das zweite Buch dreht sich um eine Ballerina, die bei einem Verkehrsunfall ein Bein verliert und dann gemeinsam mit einem Botaniker in einem Treibhaus lebt. Die Protagonistin meines dritten Romans pflegt ihren jüngeren Bruder, der an einer seltenen Krankheit leidet und bei dem sich nach und nach alle Körperzellen auflösen.
Es sind alles Geschichten, in denen etwas verschwindet. So etwas mögen die Leute.
Auf unserer Insel ist die Schriftstellerei eine Tätigkeit, die nicht besonders hoch angesehen ist. Man kann nicht behaupten, dass es hier von Büchern nur so wimmelt. Die Bibliothek neben dem Rosengarten ist eine schäbige Holzbaracke, wo es allenfalls eine Handvoll Besucher gibt. Die vermoderten Bücher kauern in den Regalen, aus lauter Angst, sich in Staub aufzulösen, sobald jemand sie aufschlägt, geschweige denn liest. Die alten Bände werden nicht restauriert, sondern irgendwann entsorgt. Deshalb wird der Bestand in dieser Bibliothek auch niemals wachsen. Aber keiner beklagt sich darüber.
Mit der Buchhandlung ist es das Gleiche. Im Einkaufsviertel gibt es keinen Laden, der so gespenstisch leer ist. Mit fahlem Teint hockt der Buchhändler mürrisch hinter Stapeln von unverkauften Büchern mit vergilbten Schutzumschlägen.
Hier leben nur wenige Menschen, die Romane lesen wollen. Meistens arbeite ich von vierzehn Uhr bis Mitternacht an meinem Manuskript. In dieser Zeit schaffe ich etwa fünf Seiten. Ich genieße es, die Kästchen auf dem Papier sorgfältig mit Zeichen auszufüllen. Es gibt schließlich keinen Grund zur Eile. Ich lasse mir sehr viel Zeit, das passende Schriftzeichen für das jeweilige Kästchen zu finden.
Mein Arbeitsplatz ist das ehemalige Büro meines Vaters. Anders als zu seiner Zeit ist heute alles viel ordentlicher. Denn für meine Romane brauche ich weder Notizen noch irgendwelche Nachschlagewerke. Auf dem Schreibtisch liegen nur ein Stapel Papier, ein Bleistift, eine Klinge zum Anspitzen sowie ein Radiergummi. Aber sosehr ich mich auch anstrenge, es gelingt mir nicht, die Leere zu füllen, die die Erinnerungspolizei hinterlassen hat.
Gegen Abend mache ich einen einstündigen Spaziergang. Dabei laufe ich an der Küste entlang zum Fähranleger, während ich auf dem Rückweg den Pfad über den Hügel nehme, der an der Vogelwarte vorbeiführt.
Die Fähre, die bereits seit langer Zeit vertäut im Hafen liegt, ist völlig verrostet. Niemand besteigt sie mehr, um irgendwo hinzufahren. Auch sie gehört zu den Dingen, die von der Insel verschwunden sind.
Eigentlich sollte der Schiffsname auf dem Bug zu erkennen sein, aber durch die Salzluft ist die Farbe abgeblättert und der Schriftzug nicht mehr lesbar. Die Bullaugen sind blind, der Rumpf, die Ankerkette und die Schiffsschraube von Muscheln und Algen überzogen. Das Schiff sieht aus wie der Kadaver eines riesigen Seeungeheuers, das langsam versteinert.
Der Mann meiner Kinderfrau hat früher als Mechaniker hier gearbeitet. Als der Fährbetrieb eingestellt wurde, war er eine Zeit lang als Wachmann in einem Lagerhaus am Hafen beschäftigt, heute lebt er an Bord des Schiffs, allein und zurückgezogen. Auf meinem täglichen Spaziergang schaue ich regelmäßig vorbei, um mit ihm zu plaudern.
»Wie geht es Ihnen?«, fragt der alte Mann und bietet mir einen Stuhl an. »Kommen Sie mit dem Schreiben voran?«
Auf der alten Fähre gibt es viele verschiedene Sitzgelegenheiten, sodass wir uns je nach Witterung und Laune auf einer Bank an Deck niederlassen oder es uns im Salon auf einem Sofa gemütlich machen.
»Nun ja, es braucht seine Zeit«, antworte ich dann.
»Passen Sie gut auf sich auf!«, sagt er jedes Mal. »Nicht jeder kann den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und sich komplizierte Sachen ausdenken. Wenn Ihre Eltern noch am Leben wären, wären sie bestimmt sehr stolz.«
Er nickt, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
»Einen Roman zu schreiben ist keine großartige Angelegenheit. Ich denke, es ist viel schwieriger, einen Schiffsmotor zu zerlegen, einzelne Teile auszutauschen und ihn dann wieder zusammenzubauen.«
»Ach, woher! Da die Schiffe verschwunden sind, gibt es ja sowieso nichts mehr für mich zu tun.«
Für einen Moment herrscht Schweigen.
»Übrigens, heute habe ich ein paar erstklassige Pfirsiche bekommen. Ich werde sie für uns aufschneiden.«
Der Alte verschwindet in der Kombüse neben dem Maschinenraum. Die Pfirsichscheiben serviert er auf einem mit Eis gekühlten und mit Minzblättern dekorierten Teller. Dazu hat er eine Kanne schwarzen Tee gebrüht. Er ist nicht nur sehr geschickt im Umgang mit Maschinen, sondern auch mit Speisen und Pflanzen.
Er ist immer der Erste, dem ich ein gedrucktes Exemplar meiner Bücher überreiche. »Ah, sieh an, das ist also Ihr neuer Roman«, sagt er dann, wobei er das Wort »Roman« voller Ehrfurcht ausspricht. Sobald er das Buch in Händen hält, verbeugt er sich. Er behandelt es, als wäre es eine Reliquie.
»Vielen Dank, haben Sie vielen Dank.«
Seine Stimme klingt belegt, als wäre er den Tränen nah, was wiederum mich verlegen macht. Leider hat er nie eine Seite meiner Romane gelesen.
Einmal habe ich ihn gefragt, wie ihm meine Bücher gefallen. Er gab mir eine verblüffende Antwort.
»Ich kann es nicht sagen. Das wäre sehr unvernünftig. Wenn ich ein Buch lesen würde, wäre ja die Geschichte aus und vorbei. Was für eine Verschwendung! Ich verwahre das Buch lieber und halte es in Ehren.«
Dann legte er es auf den Altar, der sich in der Kapitänskajüte befand und der den Göttern des Meeres gewidmet war, und faltete die Hände zum Gebet.
Beim Essen unterhalten wir uns über alles Mögliche, oft schwelgen wir einfach nur in Erinnerungen. Wir sprechen über meinen Vater, meine Mutter, über seine Frau, die sich um mich gekümmert hatte, über die Vogelwarte, über die Skulpturen meiner Mutter, über die alten Tage, als man noch mit der Fähre zu anderen Orten fahren konnte … Aber unsere Erinnerungen daran verblassen von Tag zu Tag, denn wenn Dinge verschwinden, gehen auch unsere Gedanken daran verloren. Wir teilen uns die Pfirsiche und lassen sie uns auf der Zunge zergehen, so wie die alten Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen.
Wenn die Abendsonne im Meer versinkt, gehe ich von Bord. Obwohl die Gangway nicht sehr steil ist, geleitet mich der alte Mann stets an Land. Er behandelt mich immer noch wie das kleine Mädchen, das ich einst war.
»Passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie heil nach Hause!«
»Ja,