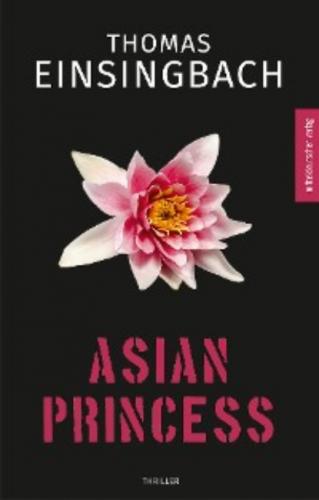„Die Bürger der Rhein-Neckar-Region können sich sicher fühlen und stolz auf ihre Polizei sein.“ Malte beendete seinen Vortrag und blickte zufrieden in den Kreis der Zuhörer. Statt eines dankbaren Beifalls erntete er eher gelangweilte Blicke. In Claudia keimte der Verdacht, dass es nicht der Pulverkaffee und die Discounter-Kekse, sondern ein ganz anderes Interesse war, das die erstaunlich umfangreiche Herde ins Polizeipräsidium getrieben hatte.
„Meine verehrten Vertreter der regionalen Medien. Sollten Ihnen die Ergebnisse unserer erfolgreichen Polizeiarbeit zu öde und zu wenig schlagzeilenträchtig erscheinen, könnten Sie Ihre Kundschaft möglicherweise durch Vergleichswerte ein wenig aufmuntern: Im ähnlich großen Stuttgarter Raum wurden im selben Zeitraum dreiundzwanzig Morde und Tötungsversuche verübt.“ Endlich kratzten die ersten Stifte über die Notizblöcke und die Kriminalrätin legte nach: „Und wem das nicht genügt, dem empfehle ich, bei jeweils vergleichbaren Einwohnerzahlen, die Partymetropole Kingston auf Jamaika, hier fielen fast fünfhundert Menschen einem vollendeten Kapitalverbrechen zum Opfer. Oder wie wär’s mit dem Urlaubsparadies Acapulco mit eintausendneunundzwanzig Mordfällen, im Durchschnitt fast drei an jedem gottverdammten Tag eines Jahres. Das sind doch wahre Paradiese für Sensationsreporter. Kein Mensch hindert Sie daran, sich dorthin versetzen zu lassen.“
Kaum war die zynische Zahlenparade verklungen, meldete sich die blonde Mitarbeiterin von Badenia-TV zu Wort und ihr Begleiter schaltete seine Kamera ein. „Frau Kriminalrätin, der Vortrag über die bemerkenswerte Arbeit unserer Polizei war nett, handelt aber von längst Vergangenem. Was zählt, ist die Gegenwart.“ Ein kühles Lächeln traf Claudia.
„Was können Sie uns über den Mord auf dem Rebheimer Madonnenberg berichten? Ist es wahr, dass der Mann asiatischer Herkunft ist? Handelt es sich womöglich um einen asylsuchenden Flüchtling? Was folgern Sie aus der Tatsache, dass die Leiche splitternackt aufgefunden wurde? Könnte das Verbrechen einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben?“
Claudia schwante Unerfreuliches. Ganz bestimmt würde der mysteriöse Leichenfund schon sehr bald auch die Bluthunde überregionaler Medien anlocken. Das provozierende Auftreten der Badenia-TV-Reporterin war ein Vorgeschmack auf das Kommende. Claudias Blick traf Polizeimeister Klingenberger, der die Pressekonferenz bis hierher konzentriert verfolgt hatte. Seine Uniform saß perfekt, immer wieder ließ er seine weißen Zahnreihen aufblitzen und trotz seiner Zurückhaltung umgab ihn eine charmante Selbstsicherheit. Alles in allem wirkte der junge Schutzpolizist eher wie ein medienerprobter, gut erzogener Fußballprofi, der jede noch so aufdringliche oder dämliche Journalistenfrage souverän wegzulächeln vermochte. Vielleicht wäre es kein schlechter Schachzug, Klingenberger, der zudem ein guter Polizist zu sein schien, vorübergehend als eine Art Pressesprecher der Sonderkommision Madonnenberg zu verwenden. Claudia war aufgefallen, wie nicht nur die forsche Fernsehreporterin den telegenen Kollegen wohlwollend taxiert hatte.
„Sie haben Glück, dass ich heute in guter Laune bin“, begann Claudia mürrisch. Sie wusste, wie unvorteilhaft ihr Äußeres auf Fotos oder in bewegten Bildern wirken konnte, und gab sich erst gar keine Mühe, freundlich zu erscheinen. „Wenn Sie keine Fragen zum Vortrag von Hauptkommissar Brettschneider haben, gebe ich Ihnen ein erstes Statement zum Stand der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem erwähnten Leichenfund. Nach meiner Erklärung ist die Pressekonferenz beendet. Sie gehen dann zum Frühstück in Ihre Redaktionen und wir können uns endlich wieder der Aufklärung von Verbrechen zuwenden.“
Ein aufgeregtes Murmeln ging durch die Reihen. Die schreibenden Journalisten setzten die Sprachaufnahmefunktion ihrer Mobiltelefone in Gang. Der Kameramann nahm Claudia Bächle-Malvert ins Visier, die grimmig ins Objektiv starrte und das Wenige wiederholte, was sich unter den Journalisten sowieso schon wie ein Lauffeuer verbreitet hatte.
6
„Bitte folgen Sie mir!“
Arusa Pisuphans Privatsekretär öffnete die zweiflügelige Tür zu einem großzügigen Empfangszimmer. „Direktor Pisuphan wird Ihnen in wenigen Minuten zur Verfügung stehen. Nehmen Sie bitte Platz. Darf ich Ihnen etwas anbieten?“
„Danke. Im Moment nicht.“
„Wie Sie wünschen.“ Der Sekretär verbeugte sich und verließ nahezu geräuschlos den Raum.
William blickte sich um. Der Salon war mit antikem chinesischen Mobiliar eingerichtet. Das meiste davon stammte aus der späten Qing-Dynastie des 19. Jahrhunderts. William kannte sich ein wenig aus, er hatte während seiner Zeit als FBI-Agent hier in Bangkok selbst einige Antiquitäten erworben. Die Wände zierten kostbare Seidentapeten. Schwere dunkelrote Samtvorhänge verhinderten den Einfall von Tageslicht und dämpften zugleich die hektischen Geräusche der Außenwelt. Der hohe Raum wurde angenehm von indirektem Licht beleuchtet. Einzelne Punktstrahler hoben wertvolle Porzellanvasen und Rollbilder mit Darstellungen aus der Zeit des kaiserlichen Chinas hervor.
Penelope hatte erwähnt, dass Arusa Pisuphan der chinesischen Minderheit Thailands angehörte, die sich trotz erfolgreicher Assimilierung überwiegend den Werten und Traditionen des Konfuzianismus verpflichtet fühlte. Wie die meisten Thai-Chinesen hatte Pisuphan seinen ursprünglichen chinesischen Familiennamen abgelegt und stattdessen einen thailändischen angenommen. Nachdem William eine Weile herumgewandert war und die Einrichtung bewundert hatte, setzte er sich in einen der Sessel aus schwarz gefärbtem Birnbaumholz, die sich um einen halbhohen Lacktisch mit Perlmuttintarsien gruppierten.
Die Klimaanlage summte dezent und William entdeckte zwei unscheinbare Überwachungskameras, die jeden Winkel des Raumes erfassten. Ließ ihn sein Gesprächspartner womöglich absichtlich warten und dabei beobachten? Offenbar war die Sache doch nicht so eilig, wie Penelope es ihm in ihrem letzten Telefonat weiszumachen versucht hatte.
William hatte seinen Erholungsurlaub auf Koh Samui zwei Tage früher als geplant beendet und war nach Bangkok geeilt, wo ihn Penelope am Flughafen in Empfang nahm. Nach einer zunächst warmherzigen Begrüßung konnte die vielbeschäftigte Juristin nur schlecht verbergen, wie sehr sie unter Zeitdruck stand. Als sie Williams Ernüchterung spürte, verschob sie kurzerhand den Nachfolgetermin und lud ihn zu einem Kaffee ein, bei dem sich ihre Angespanntheit nur unwesentlich verlor. Obwohl Penelopes Lächeln, wie damals vor einem Jahr, immer wieder aufblitzte und sie sich mehrmals auf die gewohnte vertraute Weise berührten, empfand William eine Distanz, die ihn auf schmerzliche Weise erkennen ließ, dass der Zauber ihrer Beziehung verflogen war. Während Penelope im Telegrammstil noch einmal die wichtigsten Informationen zum Auftragsangebot ihres Klienten vortrug, nippte William an seinem Getränk und hing ganz anderen Gedanken nach. War es eigentlich zwangsläufig, dass selbst einer von ganzem Herzen empfundenen Seelenverwandtschaft eine Art Verfallsdatum innewohnte, das umso näher rückte, je kleiner die Schnittmenge des gemeinsam erlebten Alltags wurde?
William riss sich von seinen Grübeleien los. Er hatte Penelope versprochen, dass er sich das Anliegen ihres Klienten anhören würde, und sein Blick streifte noch einmal durch den Salon. Eine solche Pracht hatte er nicht erwartet, als er im Gassengewirr von Bangkoks Chinatown schließlich die angegebene Adresse, einen grauen, unansehnlichen Betonklotz, an dessen Fassade deutliche Spuren der Verwitterung erkennbar waren, gefunden hatte. Endlich öffnete sich die Tür.
„Guten Tag, Mr. LaRouche. Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Hat man Ihnen eine Erfrischung angeboten?“
„Guten Tag, Khun Arusa“, grüßte William zurück und verwendete dabei die in Thailand gebräuchliche Formel der Anrede, bei der die Bezeichnung Herr mit dem Vornamen des Angesprochenen kombiniert wird. „Ja, vielen Dank. Im Augenblick möchte ich wirklich nichts.“
William hatte sich erhoben und hielt