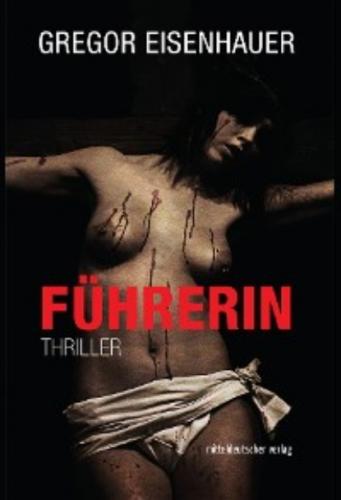Richard Claasen hatte seit Jahren keinen Artikel mehr geschrieben, dennoch redete er noch immer in der Wir-Form, wenn er seine Tochter traf. Sie hatte ihm einige kleinere Rechercheaufträge zukommen lassen, und er hatte sich alle Mühe gegeben, das nicht als Akt des Mitleids zu begreifen.
«Machen wir einen Deal wie in den guten alten Zeiten: Gib mir vierundzwanzig Stunden, um diesen Klimt zu durchleuchten …»
«Deal abgemacht. Aber bleib diskret!» Martina wusste, dass sie genauso gut einen Pinguin hätte bitten können, seinen Frack auszuziehen.
Sie stand auf und sah mit einem kindlichen Lächeln auf sein graues Haar. Es nahm ihr immer noch den Atem, wenn sie daran dachte, dass er sie überleben könnte. Der Gedanke verstörte sie nicht, er machte sie nur tieftraurig, denn sie war sich sicher, dass er es allein nicht schaffen würde.
Claasen wollte sich erheben, aber sie ahnte, dass eine Umarmung drohte, und drückte ihn wieder zurück auf den Stuhl.
«Ist schon gut, Paps! Versprochen ist versprochen! Du hängst nichts an die große Glocke!»
«Pfadfinderehrenwort!», grinste er, aber da war sie schon auf dem Weg zum Tresen, um die Rechnung zu zahlen. Im Innenhof wandte sie sich noch einmal um und winkte ihm zu. Er winkte mit beiden Händen zurück.
«Noch einen doppelten Espresso!»
Vermutlich hatte sie auch den schon bezahlt, dachte er verbittert, denn sie kannte ihn ja in- und auswendig.
Richard Claasen liebte seine Tochter über alles. Er liebte sie mit diesem völlig reinen und guten Gefühl, einem besonderen Menschen das Leben geschenkt zu haben. Tag für Tag hatte er dafür dem lieben Gott gedankt, auch wenn er eigentlich den Teufel für den Drahtzieher seines Lebens hielt. In seinen verlorensten Jahren war es immer der Gedanke an seine Tochter gewesen, der ihn vom letzten Schritt abgehalten hatte, aber in den letzten Monaten ging sie ihm gewaltig auf die Nerven.
Er hasste den Gedanken, dass die Krankheit noch einmal ausbrechen könnte, er verfluchte den Tag, da er das erste Mal davon gehört hatte. Ihr blasses durchscheinendes Gesicht nach dem Ende der Chemotherapie trieb ihn nachts um, immer wieder erschien sie ihm, ein Todesengel, der an sein Bett trat, seine Hand nahm und zart flüsterte: «Mach dir keine Sorgen!»
Verdammt noch mal, er machte sich Sorgen, verdammt große Sorgen, denn das Mädchen, das er kannte und liebte, war ihm abhandengekommen und stattdessen war eine gepanzerte Jeanne d’Arc erschienen, die glaubte, ihren Krieg gegen Gott und die Welt alleine führen zu können. Das konnte sie nicht.
«Lass dir doch einfach mal helfen, verdammt!», hatte er sie angeherrscht, als sie wieder mal sein Angebot ausgeschlagen hatte, ihr ein wenig mehr Arbeit abzunehmen. Aber sie hatte nur kühl abgelehnt. Genau diese beherrschte Kühle brachte ihn zur Verzweiflung. Er wusste auch genau warum. Ihre Mutter war genauso gewesen. Als sie ihn verabschiedet hatte, damals, vor ziemlich genau zwanzig Jahren, hatte sie keine Miene verzogen. Er wurde einfach entlassen. Aber selbst bei seiner Entlassung hatte sich der Chefredakteur um ein paar freundliche Worte bemüht, auch wenn sie beide wussten, dass die Redaktion heilfroh war, ihn loszuwerden.
Das hatte er gut verstehen können. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie unbeliebt ein cholerischer Alkoholiker war, der glaubte, alles besser zu wissen, weil er in der Steinzeit für gewaltige Schlagzeilen gesorgt hatte. Seine Kollegen waren froh, ihn losgeworden zu sein, und er war froh, diese Karriereschnösel nicht mehr sehen zu müssen.
Aber dass Alina ihn einfach so von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt hatte, das hatte er nicht so einfach weggesteckt. Obwohl er natürlich wusste, dass es ihr gutes Recht war, endlich ein eigenes Leben zu führen. Eins, in dem es nicht um Suff und Geld und Ruhm ging.
Fünf Jahre war er jetzt trocken. Nicht ein Mal hatte sie angerufen. Nicht ein Mal hatte er gewagt, sich bei ihr zu melden. Martina traf sie regelmäßig, aber mehr als ein «Geht ihr gut» war ihr nicht zu entlocken. Als ob die beiden ein Schweigegelübde abgelegt hätten. Aber kein Mensch ist so beschissen schlecht, als dass man ihn einfach für den Rest seines Lebens totschweigen durfte.
«Lass die verdammte Flucherei», ermahnte er sich selbst und dankte der Kellnerin mit einem schiefen Lächeln für den Espresso.
«Ein frisches Glas Wasser bitte noch!»
Er wusste, wo Alina wohnte, weit draußen im Westteil der Stadt, wo ihn der Zufall nicht hinführen konnte. Einfach so in die Gegend zu fahren, sich in ein Café zu setzen und auf ihr Erscheinen zu hoffen, das traute er sich nicht. Das traute er auch dem Schicksal nicht zu, dass noch ein Happy End für ihn vorgesehen war.
Die Frau am Nebentisch trank einen Prosecco. Sie war nicht sonderlich schön. Eine dieser alternden Vernissagegängerinnen, die sonst nicht mehr viel im Leben zu tun hatten. Sie wirkte nicht grade sympathisch in ihrer verkrampften Art, aus dem Museumsspaziergang das Letzte an Genuss für diesen Tag, ihren freien Tag, herauszuholen. Aber ihren Prosecco, den neidete er ihr. Seit Monaten das erste Mal. Der Wunsch, sich irrsinnig zu betrinken. Auf der Stelle. Er faltete die Hände, unentwirrbar, sodass er weder ein Glas noch eine Tasse heben konnte, und betete das Versprechen vor sich hin, das er Martina gegeben hatte, sich nie mehr, nie mehr so gehen zu lassen. Nie mehr, nie mehr sollte sie ihn so sehen. Total besoffen. Dümmer als ein Tier. Regungsloser als ein Stein.
Aber sie war ihm im Gegenzug auch etwas schuldig, dachte er verbittert. Ein wenig mehr Liebe, ein bisschen weniger Mitleid. Sie unterschätzte ihn, hielt ihn für alt und abgekämpft, aber das war er nicht, noch lange nicht. Im Fall Klimt würde er ihr das beweisen.
Donnerstag, 8. März, 12 Uhr
Grandhotel, Klimts Suite
«Was für ein Scheißpublikum …»
Klimt suhlte sich in seiner Vulgarität wie eine Wildsau im Schlamm, dachte Wilson und musterte seinen Chef leicht angeekelt. Der hätte diesen Vergleich nicht einmal übel genommen, das war sein Verständnis von Männlichkeit – raumgreifende Rüpeleien, körperlich und verbal. ‹Zu viel Hemingway in der Jugend bringt jeden Mann um seine Tugend.› Wilson ertappte sich wieder einmal dabei, dass er absurd alberne Dinge denken musste, um seinen Chef überhaupt noch zu ertragen. ‹Smile or die, rhyme or cry.›
«Diese Idioten kapieren nichts, die könnten ihre eigenen Eier gerührt auf dem Silbertablett serviert bekommen und würden auch noch Danke sagen!»
Was Wilson noch mehr abstieß als diese sinnlosen Pöbeleien, war der Applaus heischende Blick von Klimt. Der saß in seinem schmalen französischen Hotelsessel, die dicken Schenkel eng zusammengepresst, die Fäuste auf den Armlehnen geballt, und spuckte mit hochrotem Kopf Obszönität um Obszönität auf den Teppich. In Kriegszeiten wäre es vermutlich Kautabak gewesen oder Zigarrenreste. Ein wenig wirkte er wie Churchill, nur ohne Amt und Würden.
Sie hatten im Schnelldurchlauf die Videoaufzeichnung des Vortrags studiert. Nach kaum drei Minuten kam die Frage, die Wilson eigentlich gleich vorab erwartet hätte: «Wie fanden Sie mich?» Die Frage klang beiläufig, aber Robert Wilson arbeitete schon zu lange für seinen Chef, als dass er sich davon hätte täuschen lassen. «Sensationell! Wie immer. Wir haben mehr Presse als der König der Löwen Flöhe!»
«Die Scheißkerle von der Presse interessieren mich nicht! Die würden jedem für diese Story den Hintern wischen. Was sagt das Publikum? Der einfache Mann auf der Straße? Ist die Botschaft angekommen?»
«Die Lawine kommt langsam ins Rollen. Die wichtigsten Boulevardblätter widmen sich dem Thema, etwas zaghaft noch, zugegeben, aber das wird sich rasch ändern. Hier: ‹Hitlers Erben unter uns.› Nice try, oder? ‹Hitlers Testament und sein Vollstrecker!› Alles noch etwas ungelenk, die Deutschen können immer noch nicht so gut mit ihrer Geschichte. Aber der hier ist gut: ‹Mord auf Abruf!› Sie trauen der Sache alle noch nicht so recht. Dazu kommt ein durchaus vertretbares Misstrauen bei so sensationellen Enthüllungen wie der unseren. Hitlers Tagebücher wurden ja auch recht schnell wieder aus dem Regal genommen. Aber wenn Sie nach meiner ganz privaten Einschätzung fragen, insbesondere wie Ihre Person wahrgenommen