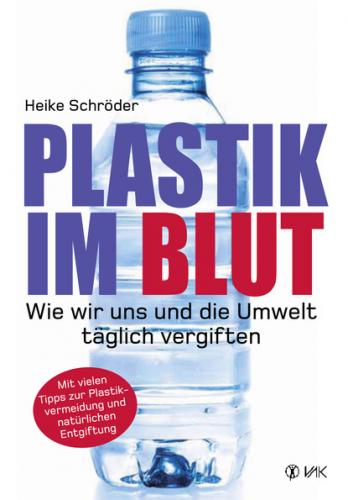Der weltweite Plastikkonsum wächst Jahr für Jahr um Millionen Tonnen. 1950 war unser Leben noch fast frei von Kunststoffen; weltweit wurden gerade einmal 1,7 Millionen Tonnen Kunststoffe hergestellt. 1989 waren es bereits 100 Millionen Tonnen, und seither hat sich die Produktion fast verdreifacht: auf 300 Millionen Tonnen im Jahr.
2. Plastik im Körper
Gefährliche Zusatzstoffe in Plastik
Nicht erst der Plastikmüll ist für die Umwelt ein gravierendes Problem – auch die Nutzung von Plastik kann schon fatale Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die Eigenschaften von Kunststoffen lassen sich durch Beimengen chemischer Zusatzstoffe beliebig modifizieren und den jeweiligen Bedürfnissen anpassen. Diese Zusatzstoffe machen erst die Eigenart eines Kunststoffs aus; sie bestimmen zum Beispiel, ob Plastik hart oder weich, biegsam oder stabil, bunt gefärbt oder transparent ist. Über diese Inhaltsstoffe von Plastik gibt es noch viel zu wenige Erkenntnisse.
Wussten Sie, dass die Hersteller von Plastikprodukten wie Plastikschüsseln, -flaschen oder Spielzeug in der Regel überhaupt nicht wissen, aus welchen Chemikalien der gelieferte Kunststoff besteht? Die Hersteller bekommen den Kunststoff normalerweise in kleinen Pellets, die sie zum jeweiligen Plastikprodukt verarbeiten. Sie wissen, dass der Kunststoff beispielsweise weich, biegsam und schwer entflammbar ist – diese Eigenschaften hatten sie bestellt. Aber welche Chemikalien für die Schaffung dieser Eigenschaften verwendet wurden, erfahren sie nicht. Das ist nämlich ein gut gehütetes Geheimnis der Plastikindustrie. Im Plastik einer Wasserflasche etwa sind mehr als 2000 verschiedene Inhaltsstoffe enthalten. Jeder Hersteller hat Geheimrezepturen, die er nicht offenlegen muss. Und so landen unzählige Plastikartikel mit bedenklichen Zusatzstoffen in unserem Haushalt.
Es ist paradox: Die Hersteller von Lebensmitteln sind gesetzlich verpflichtet, die Zutaten, Zusatzstoffe und Aromen der verwendeten Nahrungsmittel anzugeben – die Hersteller der Verpackung, deren Kunststoffe mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind dagegen nicht verpflichtet, die Inhaltsstoffe der Kunststoffverpackung anzugeben.
Wir wissen also nicht, welche Chemikalien in der Plastikfolie und den Plastikbechern, die unsere Lebensmittel beinhalten oder umschließen, enthalten sind. Wir wissen aber, dass es bei einigen der verwendeten Chemikalien Bedenken bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit gibt und dass manche Chemikalien in die Lebensmittel übergehen können. Von der Plastik- und Verpackungsindustrie wird diese Gefahr heruntergespielt: Die Verwendung von Kunststoffen in den zahlreichen Anwendungen sei geprüft und sicher.
Unabhängige Wissenschaftler sehen das aber ganz anders. Die chemischen Zusatzstoffe im Plastik sind nicht fest gebunden, sie können ausdünsten und die Atemluft und den Hausstaub belasten; Nahrungsmittel – vor allem fetthaltige oder flüssige – können die Schadstoffe aus der Kunststoffverpackung annehmen.
Die Chemikalien gelangen in unseren Körper über:
• Nahrung: Insbesondere fetthaltige Nahrungsmittel nehmen Chemikalien aus Lebensmittelverpackungen auf, wenn sie in Plastik eingeschweißt sind. Beim Erhitzen von Plastik können Chemikalien austreten und Wasser oder Lebensmittel belasten. Weichmacher können auch während der Verarbeitungsprozesse in die Lebensmittel gelangen, zum Beispiel wenn Öl durch belastete PVC-Schläuche abgefüllt wird.
• Atmung: Chemikalien dünsten aus Plastik aus und reichern sich in der Raumluft an oder gelangen durch mechanische Belastung (zum Beispiel Bodenbeläge aus PVC) in den Hausstaub und in die Raumluft. Hohe Schadstoffkonzentrationen befinden sich oft auch in Autoinnenräumen – wegen belasteter Armaturen („Neuwagengeruch“).
• Haut: Schädliche Chemikalien gelangen in die Haut, wenn Kosmetika wie Shampoos, Cremes, Nagellack oder Deos Weichmacher zugesetzt sind, oder über direkten Kontakt (Weich-PVC-Luftmatratze, PVC-Bodenbelag).
• Mund: Insbesondere Kleinkinder nehmen gerne alles in den Mund und können so über PVC-Spielzeug Weichmacher aufnehmen.
Studie: Chemikalien in Mineralwasser
In einer Studie von Martin Wagner und Jörg Oehlmann von der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde wurden 18 Mineralwässer aus Plastikflaschen auf Chemikalien getestet. Die Forscher konnten nachweisen, dass Chemikalien auf das Wasser übergehen. Sie identifizierten Spuren von mehreren Tausend Chemikalien in den getesteten Wässern, unter anderem die Weichmacherchemikalie DEHF, die eine Störung des körpereigenen Hormonsystems verursachen kann. (Wagner 2013)
Als besonders problematisch und gesundheitlich bedenklich gelten vor allem die Zusatzstoffe Bisphenol A, Weichmacher und Flammschutzmittel.
Bisphenol A (BPA)
Die chemische Substanz Bisphenol A ist in vielen Plastikprodukten enthalten. BPA ist weltweit die am häufigsten produzierte Industriechemikalie und findet sich als Weich- oder Hartmacher in vielen Alltagsgegenständen aus Kunststoff. Täglich sind wir dieser Chemikalie ausgesetzt: Wir essen Gemüse oder Fertiggerichte aus mit Kunststoff beschichteten Dosen und erhitzen unser Essen vielleicht in Mikrowellengeschirr. Wir trinken Wasser aus Plastikflaschen und geben unseren Kindern Milch in Plastik-Babyflaschen. Wir legen CDs und DVDs mit der Hand ein, tragen Kunststoffbrillen, haben Kunststoff-Zahnfüllungen oder halten beschichtete Kassenbons oder Tickets in der Hand. Definitiv befindet sich Bisphenol A in allen Produkten aus Polycarbonat – ein durchsichtiger und harter Kunststoff –, unter anderem in Flaschen und anderen Behältern für Lebensmittel. Über jedes dieser Produkte findet die Chemikalie den Weg in unseren Körper – hauptsächlich über die Nahrung, durch Lebensmittel oder Getränke, die mit BPA in Kontakt gekommen sind, aber auch über die Haut und die Atmung (belasteter Hausstaub).
Jedes Nahrungsmittel, das in einem Bisphenol-A-haltigen Behälter aufbewahrt wird, ist mit BPA belastet; dieses kann sich beim Erhitzen oder durch Säureeinwirkung besonders leicht herauslösen. Plastik in der Spülmaschine kann durch Kontakt mit heißem Wasser ebenso BPA freisetzen, das dann wiederum an anderem Geschirr haften bleibt. Zudem ist diese Chemikalie fettlöslich und belastet fetthaltige Nahrungsmittel, sobald diese mit dem Plastik in Berührung kommen.
„Die Menschen in den industrialisierten Staaten sind mittlerweile zu über 90 Prozent chronisch mit Bisphenol A (BPA) belastet, also sozusagen ,plastiniert‘“, sagt Dieter Swandulla, Institutsdirektor der Physiologie II an der Universität Bonn. „In nahezu jeder Urinprobe lassen sich nennenswerte Konzentrationen von BPA nachweisen.“ (D. Swandulla im Handelsblatt, 2013 a)
Ob dies nun ein Grund zur Sorge ist, darüber streiten sich die Wissenschaftler schon seit Jahren. Obwohl Behörden wie die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und das Bundesinstitut für Risikoforschung (BfR) die Unbedenklichkeit von Bisphenol A bei sachgemäßer Verwendung betonen, bestätigen sie gleichzeitig die Tatsache, dass sich die Chemikalie aus den Kunststoffprodukten lösen und in die Lebensmittel gelangen kann. Sie sehen darin aber keine gesundheitlichen Risiken, weil die in die Lebensmittel eintretenden Mengen viel zu gering seien. Bisphenol A gehört jedoch zu den hormonellen Schadstoffen und viele unabhängige Wissenschaftler sind der Meinung, dass BPA bereits in kleinsten Dosen in das Hormonsystem eingreifen und die Gesundheit gefährden kann.
Bisphenol A im Körper kann im Labor nachgewiesen werden.
Laborbefund für den Nachweis von Bisphenol A im Urin (Quelle: Medizinisches Labor Bremen)
Zur