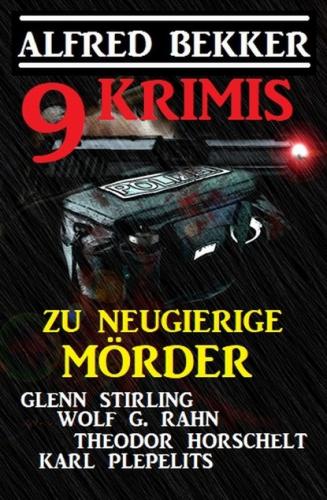„Wirklich?“, flüsterte Tipo.
„Wirklich. Und große Seen gibt es. Und jede Menge kleiner Dörfer, in denen nur fröhliche Menschen leben. Du brauchst nicht mehr zu arbeiten, niemand schreit dich an, keiner will dir etwas antun. Es ist das Paradies, Tipo, und du wirst es bald sehen. Dagegen ist diese Erde hier eine furchtbare Hölle.“
Tipo lächelte matt. „Ist es schon bald?“
„Ja, sehr bald.“
„Trinken, ich möchte...“
„Besser nicht, Tipo, dann kommen die Schmerzen wieder. Und dann ist der Weg in das neue Land nicht so schön. Dann tut es anfangs noch weh. Es soll doch nicht weh tun, Tipo. Und weißt du, dass du auch deine Mutter wiederfindest? Du hast doch deine Mutter sehr geliebt, nicht wahr?“
„Sie... sie ist tot... schon lange.“
„Sie ist auch in diesem herrlichen Land. Und sie wartet darauf, dass du kommst. Sie ist jetzt schon glücklich, weil sie weiß, dass du bald bei ihr sein wirst.“
„Und Helena? Meine Schwester? Sie ist an Typhus gestorben.“
„Auch die müsste dort sein. Alle, die gut waren, die findest du dort wieder.“
„Wirklich?“
„Ja, wirklich.“
„Ehrenwort?“
„Ganz großes Ehrenwort, Tipo!“, sagte der Baron, und es fiel ihm leicht, so etwas zu sagen.
Tipo schloss die Augen und meinte gequält: „Es tut wieder weh...“
„Das vergeht. Das besagt nur, dass du bald in dieses Land kommst.“
Er schien seinen Schmerz zu vergessen. „Wie heißt es?“, fragte er heiser.
„Paradies. Ich wollte, ich könnte es auch sehen. Ich beneide dich. Tipo. Wir alle sind verdammt neidisch auf dich, weil du so ein Glück hast...“
Tipo hatte wieder die Augen geschlossen und seine Gesichtshaut glich reinem Wachs. Plötzlich blähten sich seine Nasenflügel noch einmal, sein linker Arm zuckte, dann erschlaffte alles an ihm.
Der Baron fühlte Tipos Puls und hob dann den Kopf. Le Beaus Blick begegnete dem seinen.
„Vorbei?“, fragte Le Beau.
Der Baron nickte nur und erhob sich. Um ihn herum standen die Menschen wie gebannt. Keiner sprach. Dolly verbarg das Gesicht in den Händen, und Jenny begann plötzlich zu schluchzen. Daraufhin begann auch Nina Rosco wieder zu heulen. Der würdige Archibald Home aber blickte erst auf den Jungen, dann auf den Baron und sagte schließlich beeindruckt: „Sie haben es ihm leicht gemacht. Mein Gott, ich wünschte, ich könnte Ihnen auch zuhören, wenn es bei mir so weit ist. Er hat geglaubt, was Sie sagten.“
„Ich kann nur hoffen, dass er es geglaubt hat“, erwiderte der Baron. „Wir haben noch die traurige Pflicht, die Toten zu begraben ...“
*
Am nächsten Tag zogen Wolkenberge von Südwesten her auf die Insel zu. Die See wurde rauer, und Le Beau hatte nur eine Stunde von der Küste aus angeln können. Der alte Attache, der sich als sehr brauchbarer Helfer erwies, half ihm dabei. Doch die Ausbeute ihrer Mühe reichte gerade aus, um ein Mittagsmahl für alle zu bereiten.
Robert hatte indessen wieder die Trinkwasservorräte berechnet, und das hörte sich dann ziemlich pessimistisch an. Zehn Tage lang würden alle Wasservorräte reichen, es sei denn, es würde Regen geben. Und darauf hofften alle.
Der Baron hatte sich Dr. Rosco beiseite genommen, während James noch immer die beiden Schwarzen bewachte, nachdem die beiden noch in der Nacht vom Baron verhört worden waren.
Dr. Rosco hockte ein gutes Stück von der Baracke entfernt auf einem Trümmerstück der Sunderland, während der Baron vor ihm stand.
„Also hören Sie, Rosco, dass Sie nichts wissen, ist doch ein Märchen. Sonst wären Sie niemals weggelaufen.“
Der Baron wartete auf eine Antwort, doch die kam nicht, denn Dr. Rosco starrte verbissen in den Sand. So fuhr der Baron fort: „Der eine der beiden Schwarzen sagte, dass er und die anderen der Nationalen Freiheitsfront von Haiti angehören. Das Schiff, die Monte Christo, ist ja auch nicht rein zufällig gesunken. Das war ein Anschlag, und er galt Stevenson und Ihnen. Dabei wollte man Stevenson und Sie entführen. Weil Sie beide etwas wissen. Und Sie wissen es noch, nur der Schwarze konnte mir nicht sagen, was es ist. Nun, man begriff bald, dass etwas schiefgelaufen war. Der Mann, der die Bombe gelegt hat, wurde auf dem Schiff getötet.“
„Ja, ich habe ihn erschossen.“
„Aha, und was wollte er von Ihnen?“
Rosco sah den Baron an. „Das geht Sie nichts an.“
„Irrtum, Rosco, es geht uns alle etwas an. Wir sitzen nämlich in der Tinte, die man eigentlich nur ihretwegen angerührt hat. Es ist dann ganz gut, wenn man weiß, wie man aus ihr herauskommt. Also, was wollen diese Kerle von Ihnen?“
„Ich rede nicht darüber.“ Rosco starrte wieder in den Sand.
„Gut, wie Sie wollen. Dann werde ich den anderen sagen, dass Sie uns nicht helfen wollen. Hier gilt so etwas wie Kriegsrecht, Rosco. Man könnte Sie daraufhin absondern und von Wasser und Nahrung ausschließen.“
„Das wagen Sie nie!“
„Ich berufe mich auf Gesetze des Seerechtes, Rosco.“
Rosco hob den Kopf. „Also gut. Es ist wegen der Ölkonzessionen in Haiti.“
„Weiter!“
„Stevenson und ich haben darüber verhandelt. Deshalb bin ich mitgefahren.“
„Das kann nicht alles sein. Rosco, der Schwarze sagte, dass Ihnen auf Haiti riesige Ländereien gehören. Damit hängt das doch zusammen!“
Rosco nickte. „Ja, aber es ist mein Land, und ich kann Stevenson konzessionieren, was ich will.“
„Die Burschen von der Freiheitsfront sagen, dass Sie mit Hilfe des Staates die kleinen Bauern verdrängt haben, die vorher Ihre Pächter waren. Nur wegen des Öls? Das ist es doch, nicht wahr?“
„Es ist mein Land, und ich kann darauf tun, was ich will.“
„Gut, sagen Sie, aber diese Rebellen sehen das anders. Immerhin ist es denen gelungen, die Monte Christo zu versenken und uns hier aufzuspüren, nachdem die Kerle wussten, dass Stevenson entkommen war, Sie aber irgendwo zu finden sein mussten. Was den Rettungsflugzeugen nicht gelungen war, denen ist es geglückt. Sie fanden uns.“
„Wissen Sie wenigstens, wo wir jetzt sind?“
„Sie werden schrecklich lachen, Rosco, aber Stevensons Freundin Jenny hatte unbewusst den Namen schon selbst gefunden, als sie an Land kam. Sie sagte, dies hier sei ja eine Liebesinsel. Die Eingeborenen nennen sie wirklich so. Aber es hängt mit religiösen Riten zusammen, und den Amerikanern, die sie im Krieg besetzt hielten, hat man es nie verziehen, sie benutzt zu haben. Sie ist gewissermassen heilig. Jedes Jahr im Herbst kommen die Eingeborenen mit Booten von den Turks-Inseln herüber und setzen hier ihre Brautpaare für eine Woche aus. Sie lassen, wie mir der Schwarzer sagte, nur wenig Verpflegung und Wasser zurück, und hier soll sich bewähren, ob die Paare zusammenpassen oder nicht. Nach einer Woche werden sie wieder abgeholt und dann zu Hause getraut, falls sie das selbst noch wollen. Wir befinden uns also gut und gerne fünfzig Seemeilen von den südlichsten der Turks-Inseln entfernt. Wir könnten mit dem Rettungsboot hinkommen, vorausgesetzt, wir können sämtliche Lecks flicken, die hineingeschossen wurden. Das ist unsere Chance, sobald die See wieder ruhiger wird. Die Lecks flicken wir, und wir fangen auch bald damit an.“
Rosco schwieg.
Der Baron