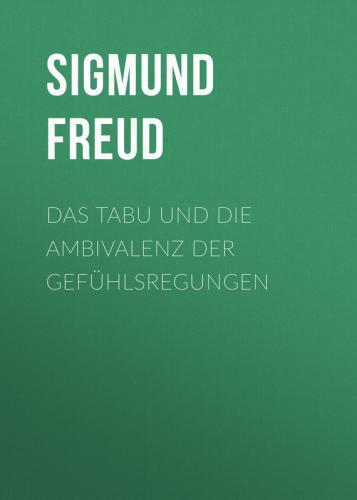Unternehmen wir jetzt den Versuch, das Tabu zu behandeln, als wäre es von derselben Natur wie ein Zwangsverbot unserer Kranken. Wir machen uns dabei von vorneherein klar, daß viele der für uns zu beobachtenden Tabuverbote sekundärer, verschobener und entstellter Art sind, und daß wir zufrieden sein müssen, etwas Licht auf die ursprünglichsten und bedeutsamsten Tabuverbote zu werfen. Ferner, daß die Verschiedenheiten in der Situation des Wilden und des Neurotikers wichtig genug sein dürften, um eine völlige Übereinstimmung auszuschließen, eine Übertragung von dem einen auf den anderen, die einer Abbildung in jedem Punkte gleichkäme, zu verhindern.
Wir würden dann zunächst sagen, es habe keinen Sinn, die Wilden nach der wirklichen Motivierung ihrer Verbote, nach der Genese des Tabu zu fragen. Nach unserer Voraussetzung müssen sie unfähig sein darüber etwas mitzuteilen, denn diese Motivierung sei ihnen »unbewußt«. Wir konstruieren die Geschichte des Tabu aber folgendermaßen nach dem Vorbild der Zwangsverbote. Die Tabu seien uralte Verbote, einer Generation von primitiven Menschen dereinst von außen aufgedrängt, d. h. also doch wohl von der früheren Generation ihr gewalttätig eingeschärft. Diese Verbote haben Tätigkeiten betroffen, zu denen eine starke Neigung bestand. Die Verbote haben sich nun von Generation zu Generation erhalten, vielleicht bloß infolge der Tradition durch elterliche und gesellschaftliche Autorität. Vielleicht aber haben sie sich in den späteren Generationen bereits »organisiert« als ein Stück ererbten psychischen Besitzes. Ob es solche »angeborene Ideen« gibt, ob sie allein oder im Zusammenwirken mit der Erziehung die Fixierung der Tabu bewirkt haben, wer vermöchte es gerade für den in Rede stehenden Fall zu entscheiden? Aber aus der Festhaltung der Tabu ginge eines hervor, daß die ursprüngliche Lust, jenes Verbotene zu tun, auch noch bei den Tabuvölkern fortbesteht. Diese haben also zu ihren Tabuverboten eine ambivalente Einstellung; sie möchten im Unbewußten nichts lieber als sie übertreten, aber sie fürchten sich auch davor; sie fürchten sich gerade darum, weil sie es möchten, und die Furcht ist stärker als die Lust. Die Lust dazu ist aber bei jeder Einzelperson des Volkes unbewußt, wie bei dem Neurotiker.
Die ältesten und wichtigsten Tabuverbote sind die beiden Grundgesetze des Totemismus: Das Totemtier nicht zu töten und den sexuellen Verkehr mit den Totemgenossen des anderen Geschlechts zu vermeiden.
Das müßten also die ältesten und stärksten Gelüste der Menschen sein. Wir können das nicht verstehen und können demnach unsere Voraussetzung nicht an diesen Beispielen prüfen, solange uns Sinn und Abkunft des totemistischen Systems so völlig unbekannt sind. Aber wer die Ergebnisse der psychoanalytischen Erforschung des Einzelmenschen kennt, der wird selbst durch den Wortlaut dieser beiden Tabu und durch ihr Zusammentreffen an etwas ganz Bestimmtes gemahnt, was die Psychoanalytiker für den Knotenpunkt des infantilen Wunschlebens und dann für den Kern der Neurose erklären.13
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.