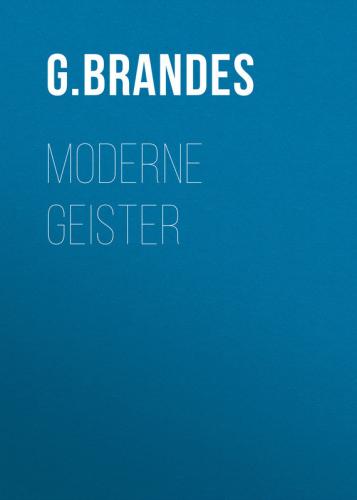Wie die meisten gebildeten Franzosen war Renan ein fast ehrfurchtsvoller Bewunderer George Sand's. Diese ausgezeichnete Frau hatte vermocht, ihre Herrschaft über die jüngeren Generationen Frankreichs auszudehnen, ohne deswegen ihren Jugendidealen untreu zu werden. Einen Idealisten wie Renan gewann sie durch ihren Idealismus, einen Naturalisten wie Taine durch die geheimnissvolle Naturmacht ihres Wesens, der jüngere Dumas, von dem man glauben sollte, dass die Helden und Heldinnen George Sand's, über die seine Dramen manchmal eine bittere Kritik üben, ihm ganz besonders zuwider seien, war vielleicht derjenige unter den nachromantischen Schriftstellern, der ihr persönlich am nächsten stand. Dumas' Begeisterung für George Sand war nur eine Folge seiner literarischen Empfänglichkeit überhaupt, der Enthusiasmus Renan's war von tieferer Art. Ebenso stark wie er Béranger hassen muss, in dem er eine Personifikation all' des Leichtfertigen und Prosaischen in dem französischen Volkscharakter sieht, und dessen philisterhafter Dieu des bonnes gens dem Herder'schen, pantheistischen Denker und Träumer ein Dorn im Auge ist, ebenso lebhafte Sympathien musste er naturgemäss für die Verfasserin von „Lélia“, „Spiridion“ und so vieler anderen schwärmerischen Schriften haben.
Trotz seines weiten Blicks ist Renan jedoch in seinen literarischen Sympathien nicht ohne nationale Beschränkung. Er hatte in einem Gespräche über England durchaus nichts Gutes über Dickens zu sagen; nicht einmal für Billigkeit war er gestimmt. „Der anspruchsvolle Stil von Dickens“ sagte er, „macht auf mich denselben Eindruck, wie der Stil einer Provinzial-Zeitung“. Sein bekannter ungerechter Artikel über Feuerbach setzt Einen weniger in Erstaunen, wenn man hört, in welchem Grade er über die Mängel bei Dickens dessen Vorzüge übersieht. Er ist derselbe bis zum Krankhaften entwickelte Sinn für eine klassische und temperirte Ausdrucksweise, der Renan die humoristischen, an die Shakespearischen Clowns gemahnenden Sonderbarkeiten in Dickens' Stil und die leidenschaftliche Form bei Feuerbach antipathisch macht; die geniale Manierirtheit des Engländers kommt ihm provinziell vor, die Gewaltsamkeit des Deutschen scheint ihm einen so zu sagen tabaksartigen Beigeschmack von der Pedanterie des studentischen Atheismus zu haben. Er ist in seinem literarischen Geschmack Romane und Pariser, classisch und gedämpft.
II
Renan stand im Vorsommer 1870 in Begriff, eine Reise nach Spitzbergen in Begleitung des Prinzen Napoleon anzutreten. Kurz vor dieser Reise sprach er eines Tages von Politik. „Sie können“, sagte er, „den Kaiser vollständig durch seine Schriften kennen lernen.23 Er ist ein Journalist auf dem Thron, ein Publicist, der immer die öffentliche Meinung ausfragt. Da seine ganze Macht auf ihr beruht, braucht er trotz seines geringeren Gehalts mehr Kunst als Bismarck, der sich über alles hinwegsetzen kann. Bis jetzt ist er nur körperlich, nicht geistig geschwächt, aber er ist äusserst vorsichtig geworden (extrêmement cauteleux) und hat ein Misstrauen in sich selbst, das er früher nicht kannte“. Renan urtheilte über Napoleon ungefähr wie Sainte-Beuve in dem bekannten nach seinem Tode herausgegebenen Fragment über „Das Leben Cäsars“, in welchem er die Cäsaren „zweiter Classe“ schildert, jene die „im Purpur oder neben dem Purpur geboren“ sind und „etwas Gequältes, Ausgearbeitetes, Fabricirtes“ an sich haben. Ollivier, den Renan schon sehr lange kannte und der eben in jenen Tagen seine kurze Rolle als anscheinend constitutioneller Premierminister spielte, beurtheilte er mit Strenge. Er sagte: „Er und der Kaiser passen vorzüglich zusammen. Sie sind geistig verstanden Verwandte, sie haben dieselbe Art von ehrgeiziger Mystik, sind so zu sagen durch die Chimäre verschwägert“. Schon im Jahre 1851 hatte Ollivier oft zu Renan gesagt: „Sobald ich ans Ruder komme, sobald ich Premier-Minister werde …“
Wenn ich nun in diesen Gesprächen mit meinem damaligen einfachen politischen Grundgedanken, der Nothwendigkeit des Schulzwangs, des unentgeltlichen oder doch äusserst billigen Unterrichts auch für Frankreich, hervorrückte, einem Gedanken, den ich überall zu vertheidigen Anlass hatte und der überall wie eine Ungereimtheit oder eine alte längst aufgegebene Schrulle behandelt wurde, war Renan nach meinen Vorstellungen so paradox, dass ich kaum an seinen Ernst glauben konnte. Seine Argumente haben besonders deswegen Interesse, weil man sie (nur in anderer Form) allenthalben in Frankreich von den Männern des zweiten Kaiserreichs vorbringen hörte. Renan behauptete erstens, gezwungener Unterricht sei eine Tyrannei. „Ich habe selbst“, sagte er „ein kleines Kind, das gebrechlich ist. Wie despotisch, es von mir zu nehmen, um es zu unterrichten!“ Ich entgegnete, dass es durch das Gesetz Ausnahme gäbe. „Dann würde Niemand die Kinder in die Schule schicken“, antwortete er. „Sie kennen nicht unsere französischen Bauern. Sie würden sich nie was daraus machen. Lassen Sie sie die Erde bauen und ihre Steuern zahlen oder geben Sie ihnen ein Gewehr in die Hand und einen Sack auf den Rücken, und sie sind die besten Soldaten der Welt. Aber was für die eine Race passt, passt für die andere nicht. Frankreich ist kein Land wie Schottland oder Skandinavien; die puritanischen und germanischen Gewohnheiten finden hier keinen Boden. Frankreich ist z. B. kein religiöses Land und jeder Versuch, es dazu machen zu wollen, wird scheitern. Es ist ein Land, das zwei Sachen hervorbringt; was gross und was fein ist (du grand et du fin). Die respektable Mittelmässigkeit wird nie hier gedeihen. In diesen zwei Worten ist das ideale Bedürfniss der Bevölkerung ausgedrückt; im Uebrigen will sie nur eins, sich amüsiren, durch Vergnügungen empfinden, dass sie lebt. Und endlich, glauben Sie mir, es ist meine feste Ueberzeugung, dass der elementare Unterricht geradezu ein Uebel ist. Was ist ein Mensch, der