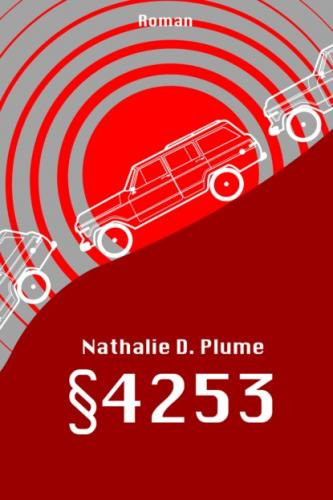und im Moment können wir uns
aus dem von uns angerichteten Schlamassel
noch herausziehen.
Salman Rushdie
Jahre können vergangen sein, Monate verstrichen oder auch nur wenige Sekunden an einem vorbeigerannt, doch nun befindet sich die Erde an ihrem Limit. Es wird nicht morgen so weit sein, nicht in einem Jahr und auch nicht jetzt! Vielmehr war der Punkt, den die Erde nun erreicht hat, gestern. Gestern hätten wir etwas tun müssen, nicht erst morgen. Der stetige Fortschritt unserer Rasse fordert nun ihren Tribut. Umweltkatastrophen, Nahrungsmittelknappheit, brennende Wälder, überflutete Dörfer, Seuchen und mehr Smog, als die wenigen unserer Bäume je schlucken können.
Aus Verzweiflung über die immer dramatischer werdenden Veränderungen des Planeten hat die Politik nun zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Sie hat verstanden, dass das Einsparen von Plastiktüten im Supermarkt, der Ausbau von Fahrradwegen und geringfügig höhere Steuern nicht ankommen gegen die bereits angerichteten Schäden. So schuf sie einen Paragrafen, der das Leben aller Menschen verändern soll. Einen Paragrafen, der allem zu schnell entwickeltem und nie durchdachtem Fortschritt ein Ende machen soll. Die Folgen: eine Welt ohne Kunststoff, Autos, Flugzeuge, Boote und all den Dingen, die für uns alle schon so normal geworden sind, die unserer Heimat aber Schritt für Schritt weiter den Dolch in die Brust rammen. Eine so drastische Entscheidung hat Folgen für jeden Menschen. Eine Entscheidung, die das Leben vieler auf den Kopf stellt und einiger sogar riskiert. Wie weit darf man gehen, um den Planeten zu retten?
Prolog
Es ist kalt, der Wind regiert das kleine Küstendorf mit eiserner Hand und obwohl die Sonne sich langsam durch den dichten Nebel kämpft, scheint es, als würde sie den Kampf gegen Wind, Wasser und Smog nicht gewinnen können. Das kleine Mädchen, das im Schutz eines Felsvorsprungs im Sand sitzt, hat ihre kleinen Fäuste fest in den Taschen ihres braunen Mantels versenkt und kneift diese so fest zu, als könne sie den tosenden Wind damit ersticken. Die Knie, die sie nach oben an ihre Brust gezogen hat, so dass sie unter dem großen Mantel Schutz finden, schmerzen und obwohl ihr linker Fuß kribbelt und der rechte schon längst eingeschlafen ist, trotz der Nase, die nicht nur mehrfach die Farbe gewechselt hat und nicht mehr länger nur rot, sondern blau wie das Meer ist, trotz alldem starrt das kleine Mädchen an den Strand und auf die dicken Wellen, die sich eine nach der anderen ans Ufer drücken. Sie muss warten, denkt sie, nur noch ein bisschen, dann werden sie kommen, ganz sicher. Sie will dabei sein, wenn ihre kleinen Augen zum ersten Mal das Licht der Welt sehen und sie will dabei sein, wenn sie sich mit ihren winzigen Flossen den Weg durch den nassen, rauen Sand ins sichere Meer bahnen. So sitzt sie da, frierend unter einem Felsvorsprung, darauf wartend, dass sie kommen; und wenn sie den ganzen Tag so ausharren muss, sie würde dort sein und sie sehen, ganz bestimmt.
Was das kleine Mädchen nicht weiß, ist, dass sie an diesem Tag nicht kommen werden, sie werden nicht aus ihren Eiern schlüpfen und zu Hunderten den Weg in ihr Leben antreten, sie werden nicht an diesem Tag schlüpfen und sie werden es auch nicht am nächsten und übernächsten, nicht am Tag danach und dem danach. Doch das weiß das kleine Mädchen nicht, denn sie wird dasitzen und ihre kastanienbraunen Locken werden ihr noch viele weitere Tage um den Kopf wehen, bis sie eine unzähmbare Masse ergeben; sie wird noch an vielen weiteren Tagen ihre Füße nicht spüren und sie wird viele weitere Tage so lange durch ihre tränenden Augen auf den Strand und die Wellen starren, bis sie sich ganz sicher sein kann.
Sie wird warten.
1. Rügen, Deutschland
Die Tür, die eben noch freundlich und einladend weit offen gestanden hat, fliegt mit einem lauten Knall ins Schloss. Die kleinen Fenster, die in der blauen Tür eingelassen sind, zerbersten, fast so, als wollten sie sich mit dem Mann, der nun hinter der Tür verschwunden ist, solidarisch zeigen. Dieser Mann steht nun, da sich die erste Aufregung und Wut gelegt hat, allein in dem kleinen Raum, der sich jetzt hinter der Tür verbirgt. Er steht nur da, die breiten Schultern heben und senken sich schnell und seine Fingernägel bohren sich, in den geballten Fäusten versteckt, in die Haut. Seine Füße stehen fest am Boden, jedoch bereit sich sofort und blitzschnell vom Boden abzustoßen und ohne Vorwarnung loszurennen und niemals stehen zu bleiben. Seine Augen wandern immer noch zu Schlitzen geformt durch den kleinen Raum. Das Erste, was sie sehen, ist der kleine Tisch, der nach dem Betreten gleich links neben der Tür steht. Voll mit Unterlagen, Bauzeichnungen, Rechnungen und Reklamationen, alle kreuz und quer über ihn verteilt, still darauf wartend, einer nach dem anderen bearbeitet und abgeheftet zu werden. Zwischen ihnen der alte Computerbildschirm, den seine Tochter immer als so wahnsinnig altmodisch beschreibt, und daneben die winzige Schreibtischlampe, die mit ihrem Kopf aus den Papieren hervorschaut, deren Hals und Sockel aber nur höchst selten mal zu sehen sind. Der alte verzierte Bilderrahmen, der sonst immer vor dem Bildschirm und neben dem kleinen gläsernen Okapi gestanden hat, ist durch die Erschütterung der Tür umgekippt und verbirgt nun die einst so glückliche Familie unter sich. Die Frau, die den kleinen Jungen auf dem Arm trägt, und das Mädchen, das mit rollenden Augen zu ihrem Bruder hochblickt und ihn davon abzuhalten versucht, ihre Haare in seinem Mund verschwinden zu lassen. Der kleine Junge lächelt dabei so sehr, dass man ihm kaum böse sein kann, und auch die Frau, die ihn trägt, mit den glatten langen Haaren, lacht bis zu ihren Augen herzhaft darüber. Hinter ihnen steht ein Mann, der sich wegen seiner Größe leicht herunterbeugen muss, um auch noch auf dem Foto Platz zu finden; er umgreift seine kleine Familie so fest mit seinen starken, langen Armen, als könnten sie sonst vom Wind fortgetragen werden. Auch er lächelt zufrieden.
Links neben dem Schreibtisch stand der lange Garderobenständer, der unter der Last des Mantels, den er trug, bei jedem Windzug hin- und hergetragen wurde, jetzt liegt er, gerade so, als wollte er die Tür ab heute für immer verschließen, gegen den Türknauf gelehnt. Der schwere Mantel hat sich von ihm gelöst und säumt den Boden. Außer der Palme, die kaum noch ein grünes Blatt trägt, ist da nicht mehr viel, wobei nicht mehr viel nicht der richtige Begriff ist, denn mehr als diese einsamen Möbelstücke hätten in das kleine Büro auch kaum hineingepasst.
Es ist gerade genug Platz für diese paar Dinge gewesen, als er vor zwei Jahren in diesen kleinen Raum gezogen war. Damals war er so stolz, dass er ihm so groß wie ein Apartment vorgekommen war, da wusste er, dass hier seine ganze Welt hineinpassen würde, und er vergaß schnell, dass er für diese Beförderung seine Seele verkauft hatte. Dass er die Zeit zu seiner Familie beschnitten hatte, so stark sie es eben von ihm gefordert hatten und fordern würden. Jetzt kommt es ihm so vor, als würden die grauen Wände des kleinen Raums immer näherkommen, so als wollten sie ihn ersticken und seine schöne Welt, wie den Eiter eines Pickels, einfach aus ihm herausdrücken. Er sieht durch das winzige Fenster, seine Augen wandern über die trockenen Wiesen an den großen Felsen vorbei aufs Meer hinaus und über die großen tosenden Wellen, bis zum Horizont. Sonst ist er immer zum Greifen nah gewesen, an manchen Tagen hatte der Horizont ihn sogar zu sich gerufen, doch heute liegt er so weit weg und ist so still, als wolle auch er zeigen, wie angewidert er von dem heutigen Tag ist.
Langsam und kaum merklich entspannen sich seine breiten Schultern, seine zuvor noch schwere Atmung wird flacher und seine Fäuste lösen sich langsam aus ihrer Erstarrung und formen sich wieder zu großen Händen. Händen, die aussehen, als hätten sie niemals harte Arbeit gescheut. Die dicke Hornhaut schützt sie noch immer vor Schrauben, Bohrern und Metallen, die sich viele Jahre in sie hineingruben, und obwohl sie das schon eine Weile nicht mehr tun, würden die Schwielen, die durch jahrelange Arbeit entstanden sind, niemals mehr verschwinden. Nachdem sich auch die zweite Faust gelöst hat, fällt ein kleiner Papierball zu Boden, der sich zuvor in ihr versteckt hat, so, als fürchte er entdeckt zu werden. Der Mann, der immer noch groß, aber deutlich zusammengesunkener