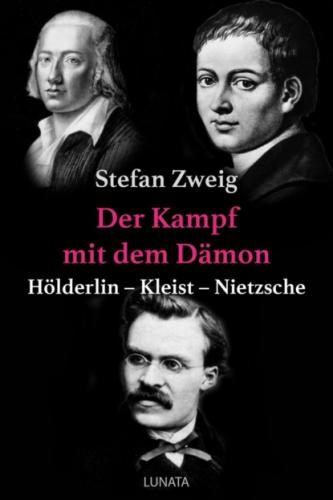Nur in diesem Sinne habe ich, nicht in dem einer (im Leben zwar vorhandenen) Rivalität, Goethes Gestalt gegen die drei Dichter und Diener des Dämons gestellt: ich glaubte einer großen Gegenstimme zu bedürfen, damit nicht das Exaltative, das Hymnische, das Titanische, das ich in Kleist, Hölderlin und Nietzsche darstellend verehre, als die einzige oder als die sublimste Kunst im Sinne eines Werts erscheine. Gerade ihr Widerspiel will mir als geistiges Polaritätsproblem höchsten Ranges erscheinen: so mag es nicht überflüssig sein, wenn ich diese immanente Antithese in einigen ihrer Beziehungen übersichtlich abwandle. Denn beinahe mathematisch formelhaft setzt sich diese Kontrastierung aus der umfassenden Form bis in die kleinsten Episoden ihres sinnlichen Lebens fort: nur der Vergleich zwischen Goethe und den dämonischen Widerpartnern gibt, als ein Vergleich der höchsten Wertformen des Geistes, Licht bis in die Tiefe des Problems.
Was zunächst an Hölderlin, Kleist und Nietzsche sinnfällig wird, ist ihre Unverbundenheit mit der Welt. Wen der Dämon in der Faust hat, den reißt er vom Wirklichen los. Keiner der drei hat Weib und Kind (ebensowenig wie ihre Blutsbrüder Beethoven und Michelangelo), keiner Haus und Habe, keiner dauernden Beruf, gesichertes Amt. Sie sind nomadische Naturen, Vaganten in der Welt, Außenseiter, Sonderbare, Mißachtete, und leben eine vollkommen anonyme Existenz. Sie besitzen nichts im Irdischen: weder Kleist, noch Hölderlin, noch Nietzsche haben jemals ein eigenes Bett gehabt, nichts ist ihnen zu eigen, sie sitzen auf gemietetem Sessel und schreiben an gemietetem Tisch und wandern von einem fremden Zimmer in ein anderes. Nirgends sind sie verwurzelt, selbst Eros vermag nicht dauernd zu binden, die sich dem eifersüchtigen Dämon vergattet haben. Ihre Freundschaften werden brüchig, ihre Stellungen zerstieben, ihr Werk bleibt ohne Ertrag: immer stehen sie im Leeren und schaffen ins Leere. So hat ihre Existenz etwas Meteorisches, etwas von unruhig kreisenden, stürzenden Sternen, indes jener Goethes eine klare, geschlossene Bahn zieht. Goethe wurzelt fest und immer tiefer, immer breiter greifen seine Wurzeln aus. Er hat Weib und Kind und Enkel, Frauen umblühen sein Leben, eine kleine, aber sichere Zahl von Freunden umsteht jede seiner Stunden. Er wohnt im weiten, wohlhabenden Haus, das sich mit Sammlungen und Seltenheiten füllt, er wohnt im warmen, schützenden Ruhm, der mehr als ein halbes Jahrhundert seinen Namen umfängt. Er hat Amt und Würde, ist Geheimrat und Exzellenz, alle Orden der Erde blitzen von seiner breiten Brust. Bei ihm wächst die irdische Schwerkraft im Maße wie bei jenen die geistige Flugkraft, und so wird sein Wesen immer seßhafter, sicherer mit den Jahren (indes jene immer flüchtiger, immer unsteter werden und wie gejagte Tiere über die Erde rennen). Wo er steht, ist das Zentrum seines Ich und zugleich der geistige Mittelpunkt der Nation: von festem Punkte, ruhend-tätig umfaßt er die Welt, und seine Verbundenheit reicht weit hinweg über die Menschen, sie greift hinab zu Pflanze, Tier und Stein und vermählt sich schöpferisch dem Element.
So steht der Herr des Dämons am Ende seines Lebens mächtig im Sein (indes jene zerrissen werden wie Dionysos von der eigenen Meute). Goethes Existenz ist eine einzige strategische Weltgewinnung, während jene in heldischen, aber niemals planhaften Kämpfen abgedrängt werden von der Erde und ins Unendliche flüchten. Sie müssen sich gewaltsam über das Irdische hinausreißen, um dem Überweltlichen vereint zu sein – Goethe braucht nicht mit einem Schritt die Erde zu verlassen, um die Unendlichkeit zu erreichen: langsam, geduldig zieht er sie an sich. Seine Methode ist derart eine durchaus kapitalistische: er legt jedes Jahr ein gemessenes Teil an Erfahrung als geistigen Gewinn sparend zurück, den er am Jahresende als sorgfältiger Kaufmann dann ordnend in seinen »Tagebüchern« und »Annalen« registriert, sein Leben trägt Zins wie der Acker die Frucht. Jene aber wirtschaften wie Spieler, immer werfen sie, in einer herrlichen Gleichgültigkeit gegen die Welt ihr ganzes Sein, ihre ganze Existenz auf eine Karte, Unendliches gewinnend, Unendliches verlierend – das Langsame, das Sparbüchsenhafte des Gewinns ist dem Dämon verhaßt. Erfahrungen, die einem Goethe das Wesenhafte des Daseins bedeuten, haben für sie keinen Wert: so lernen sie nichts an ihren Leiden als verstärktes Gefühl und gehen als Schwärmer, als heilig Fremde sich selber verloren. Goethe aber ist der ständig Lernende, das Buch des Lebens für ihn eine unablässig aufgeschlagene Aufgabe, die gewissenhaft, Zeile um Zeile, mit Fleiß und Ausdauer bewältigt werden will: ewig fühlt er sich schülerhaft, und spät erst wagt er das geheimnisvolle Wort:
Leben hab ich gelernt, fristet mir, Götter, die Zeit.
Sie aber finden das Leben weder erlernbar noch lernenswert: ihre Ahnung höheren Seins ist ihnen mehr als alle Apperzeption und sinnliche Erfahrung. Was ihnen der Genius nicht schenkt, ist ihnen nicht gegeben. Nur von seiner strahlenden Fülle nehmen sie ihr Teil, nur von innen, von dem auf gehitzten Gefühl lassen sie sich steigern und spannen. So wird Feuer ihr Element, Flamme ihr Tun, und dies Feurige, das sie erhebt, zehrt ihnen das ganze Leben weg. Kleist, Hölderlin, Nietzsche sind verlassener, erdfremder, einsamer am Ende ihres Daseins als am Anbeginn, indes bei Goethe zu jeder Stunde der letzte Augenblick der reichste ist. Nur der Dämon in ihnen wird stärker, nur das Unendliche durchwaltet sie mehr: Es ist Armut an Leben in ihrer Schönheit und Schönheit in ihrer Armut an Glück.
Aus dieser durchaus polaren Einstellung ins Leben ergibt sich bei innerster Verwandtschaft im Genius ihr verschiedenes Wertverhältnis zur Wirklichkeit. Jede dämonische Natur verachtet die Realität als eine Unzulänglichkeit, sie bleiben – Hölderlin, Kleist, Nietzsche, jeder in einer andern Weise – Rebellen, Aufrührer und Empörer gegen die bestehende Ordnung. Lieber zerbrechen sie, als daß sie nachgeben; bis ins Tödliche, bis in die Vernichtung treiben sie ihre unbeirrbare Intransigenz. Dadurch werden sie (prachtvolle) tragische Charaktere, ihr Leben eine Tragödie. Goethe dagegen – wie deutlich war er über sich selbst! – vertraut Zelter an, er fühle sich nicht zum Tragiker geboren, »weil seine Natur konziliant sei«. Er will nicht wie jene den ewigen Krieg, er will – als »erhaltende und verträgliche Kraft«, die er ist – Ausgleich und Harmonie. Er unterordnet sich mit einem Gefühl, das man nicht anders als Frommheit nennen kann, dem Leben als der höheren, der höchsten Macht, die er in allen Formen und Phasen verehrt (»wie es auch sei, das Leben, es ist gut«). Nichts nun ist diesen Gequälten, Gejagten, Getriebenen, den vom Dämon durch die Welt Gerissenen fremder, als der Wirklichkeit solch hohen Wert oder überhaupt irgendeinen zu geben: sie kennen nur die Unendlichkeit, und als einzigen Weg, sie zu erreichen, die Kunst. Darum stellen sie die Kunst über das Leben, die Dichtung über die Realität, sie hämmern sich wie Michelangelo durch die tausend Steinblöcke blindwütig, finsterglühend, in immer fanatischerer Leidenschaft durch den dunklen Stollen ihres Daseins dem funkelnden Gestein entgegen, das sie tief unten in ihren Träumen fühlen, indes Goethe (wie Leonardo) die Kunst nur als einen Teil, als eine der tausend schönen Formen des Lebens fühlt, die ihm teuer ist wie die Wissenschaft, wie die Philosophie, aber doch nur Teil, ein kleiner wirkender Teil seines Lebens. Darum werden