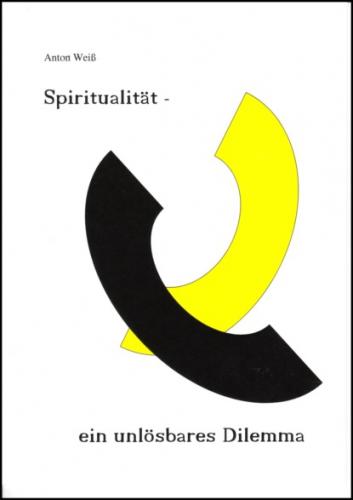Erschütternde Grunderfahrung
„Wie viele Jahre habe ich damit verbracht, Kerzen und Räucherstäbchen abzubrennen? Zu meditieren? Gurus und Lehrern hinterher zu jagen, diesen ganzen Schrott zu lesen, jedes dämliche neue Buch zu lesen? Aber jetzt erkenne ich klar, vollkommen klar, dass alles, was ich tat und warum ich es tat, nur dazu diente, dem hier aus dem Weg zu gehen! Mir aus dem Weg zu gehen, ... um diese eine Sache nicht tun zu müssen“ (Julie in SuE S. 67).
Das ist eine der erschütternden Grunderfahrungen auf dem spirituellen Weg: Dass man nach vielen Jahren eifrigen Bemühens erkennen muss, dass alles nur dazu gedient hat, den entscheidenden Schritt eben nicht zu tun. Dass man alles tut, jede Marter, jede Qual, jede noch so anstrengende Übung auf sich nimmt, nur um das Eine nicht tun zu müssen: nämlich sich selbst zu geben. Unsere ganze spirituelle Suche ist letztlich ein Selbstbetrug, dient dazu, das eine nicht tun zu müssen, was das einzige ist, was wirklich befreien würde: Sich selbst zu geben. Wahrscheinlich fragt man sich, was es heißt, „sich selbst zu geben“. Aber da stößt man sprachlich schon an eine Grenze. Da muss man die Erfahrung haben, wie sie das obige Zitat zum Ausdruck bringt, dass man alles tut, nur um dem Eigentlichen aus dem Weg zu gehen. Dieses Eigentliche ist das ganz einfache Tun, ist das Leben aus der Einheit, die man immer schon ist. Nur im Ich weigert man sich, eben der zu sein, der man ist. Denn als Ich will man bedeutend sein, will Geltung haben, braucht Anerkennung.
Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen: In einem Interview in der Südd. Zeitung vom 6./7. März 2010 erzählt der Regisseur Michael Haneke von einer Fehlbesetzung in Hebbels „Maria Magdalena“. „Der Schauspieler, der den Leonhard spielte, sollte reinkommen, seinen Hut an die Wand hängen und grüßen. Wir haben einen ganzen Vormittag nur geprobt, wie er rein kommt, seinen Hut an die Wand hängt und grüßt. Es war unmöglich, dass er einfach rein kommt, seinen Hut an die Wand hängt und grüßt. Er hat mir die ganze Zeit vorgespielt, dass er rein kommt, den Hut an die Wand hängt und grüßt.“ Wer das versteht, müsste auch das oben Gesagte verstehen: Es zeigt den Unterschied zwischen Handeln des Ichs und dem einfachen Handeln, den Unterschied zwischen Bemühen und „einfach zu sein“.
Ich kann es noch an einem anderen Beispiel verdeutlichen: Wenn ich sage: „Seien sie einfach“, dann fragen Sie, wie Sie das machen sollen. Wenn ich zu Ihnen sage: „Heben Sie den Arm“, dann heben Sie den Arm. Sie haben nicht gefragt, wie Sie das machen sollen, Sie haben einfach den Arm gehoben. Es ist aber beides das gleiche: Sie wissen nicht, wie Sie es machen sollen, „einfach zu sein“; Sie wissen aber auch nicht, wie Sie den Arm heben: Man tut es einfach, ohne nachzudenken, ganz spontan, ohne die Frage, wie man es macht.
Noch ein Gedanke zum „Bemühen“. Es ist ganz klar, dass Erleuchtung nicht durch Bemühen zustande kommen kann, denn Bemühen setzt ein Ich voraus, und genau das soll ja überwunden werden. Mir stellt sich das Problem so dar: Ohne willentliches Bemühen ist die Erleuchtung nicht zu erlangen, aber Erleuchtung wird nicht durch willentliches Bemühen erreicht. Das scheint eine sehr widersprüchliche Aussage zu sein, trifft die Sachlage aber exakt. Ich glaube es an dem Chemiker Kekulé zeigen zu können: Hätte Kekulé sich nicht darum bemüht, die Formel des Benzols zu entdecken, wäre ihm das sicher nicht gelungen. Die Entdeckung war aber nicht die direkte Frucht seines Bemühens, sondern sie war eine Eingebung, ein Geschenk: Er starrte ins Kaminfeuer und vor seinem geistigen Auge fassten sich Schlangen am Schwanz und bildeten einen Kreis: Das erweckte in ihm die Formel des Benzolrings.
Ein Leben aus sich selbst heraus ist überhaupt nichts Besonderes, ist das ganz Einfache, das Normale. Es ist das, was der Mensch im Ich möchte, aber nicht leisten kann und paradoxerweise nicht leisten will. Denn dieses Höhere Ich werden bedeutet den Tod des Ichs. Und davor schreckt man zurück und deshalb ist letztlich alles, was man tut, auch in der spirituellen Suche, eine Flucht vor sich selbst.
Was du auch tust, du flüchtest vor dir selbst. Die ganze Hektik unserer Zeit ist nichts anderes als Ausdruck dieser Tatsache, dass der Mensch vor sich selbst davonläuft.
Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten ihre Hektik mit Sachzwängen rechtfertigen, das ist ja die typische Haltung des Ichs, selber für sein Tun nicht die Verantwortung zu übernehmen. Dass auch der spirituell Suchende durch sein Suchen sich eine Rechtfertigung verschafft, das eine Notwendige nicht tun zu müssen, das bedarf schon eines scharfen Hinsehens bei sich selbst, man muss sich gnadenlos im Spiegel anschauen, darf sich keine Ausflucht gewähren. Denn diese Erkenntnis ist deshalb so schmerzlich und deshalb wehrt sich der Mensch so dagegen, weil dahinter die Erkenntnis lauert, dass es den Tod des Ichs bedeutet, was ungeheuer schmerzlich ist und was der Mensch im Ich gar nicht leisten kann. Es beinhaltet das Eingeständnis, das Entscheidende im Leben als Ich nicht vollbringen zu können. Es ist der absolute Tiefschlag, der dem Ich verpasst wird, einräumen zu müssen, dass es etwas nicht kann und zwar etwas nicht kann, was das einzig Wichtige im Leben ist: nämlich sich selbst zu transzendieren und damit sich selbst zu geben und als der einfache und natürliche Mensch zu leben, der man im Grunde ist.
Das Ich will beruhigt werden
Ich verwende eine Passage aus SuE S. 257:
In einem Kreis spirituell Suchender geht es um die Frage, was gesucht wird. Warum bemühen wir uns? Was wollen wir? „Also ich würde sagen: Freiheit oder Glückseligkeit oder Erleuchtung.“ Er sieht die anderen an, und keiner hat eine bessere Antwort parat. Da wird McKenna gefragt: „Was würdest du sagen?“ Seine Antwort: „Ich würde sagen, man will entweder beruhigt oder aus der Fassung gebracht werden. Im Grunde genommen beides, aber am meisten beruhigt. Das Ego möchte beruhigt werden, doch der Teil von euch, der aus der Fassung gebracht werden möchte, jene leise, nagende Stimme im Hintergrund, das ist der Teil, der dafür sorgt, dass etwas geschieht, und irgendwann, in irgendeinem Leben, ist dieser winzig kleine Halunke groß genug geworden, um etwas tun zu können. Er greift sich das Steuer und wirft es über Bord, und dann knallt es und brennt es in eurem Leben. Damit fängt alles an. ... Dann wird das Schlimmste passieren, etwas, dem ihr sogar den Tod vorziehen würdet, wenn ihr die Wahl hättet. Euer Leben wird zum schlimmsten aller Alpträume, und das ist der Punkt, wo alles sich zum Guten wendet.“
Das ist es, was mich zum ersten Mal mit voller Wucht bei R. de Martino im Jahr 2000 – also in meinem 60sten Lebensjahr – getroffen hat: Die Erkenntnis, dass das Schlimmste passieren muss, etwas, dem man sogar den Tod vorziehen würde. Es ist die existenzielle Erkenntnis von der Unmöglichkeit, sein Ich zu durchbrechen, die Tatsache des ausweglosen Gefangenseins im Ich. Ich muss mich korrigieren: Es war noch nicht das existenzielle Betroffensein, sondern nur ein intellektuelles. Das existenzielle Betroffensein geschah erst 2005, was ich ausführlich in „Mein Weg aus der Ausweglosigkeit“ geschildert