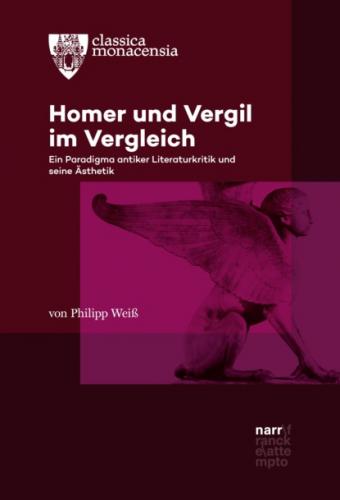Natur (… illi naturae caelesti atque inmortali …) und Kultur (… curae et diligentiae …) sind hier als poetologische Prinzipien deutlich kontrastiert. Auch Alcimus geht von einem ähnlichen Begriffspaar aus, wenn er den „wohlbebauten Acker“ Vergils von Homers „gewaltigen Feldern“ abgrenzt (s.o.). Quintilian verknüpft mit Vergil und Homer zwei gegensätzliche Grundvorstellungen, die die Rezeption beider Dichter bis in die Neuzeit prägen sollten.8
Für Quintilian besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen dem homerischen vergleichbaren Grad an Vollkommenheit zu erreichen – ars und natura werden im zweiten Satz des zitierten Abschnitts nicht hierarchisiert. Allerdings ist für Vergil im Wettkampf mit Homer ein anderes Mittel angezeigt, nämlich eben diese ars, d.h. die gleichmäßige künstlerische Ausarbeitung (vgl. aequalitate) des ganzen Werks, wodurch allein der Vorsprung der homerischen Schöpfung mit ihren unübertrefflichen Einzelinspirationen (vgl. eminentibus) eingeholt werden kann.
Ein drittes Epigramm, wieder mit dem Namen des Alcimus verbunden, lotet ebenfalls die Möglichkeiten, Homer zu erreichen, aus. Es ist in einer Abschrift des Humanisten Claude Binet erhalten und trägt beide Dichternamen im Titel (De Vergilio et Homero; Anth. Lat. 713 2Riese):9Anthologia Latina713 R.
Maeonio vati qui par aut proximus esset, | Consultus Paean risit et haec cecinit: | Si potuit nasci, quem tu sequereris, Homere, | Nascetur, qui te possit, Homere, sequi.
(„Als man Apollo befragte, wer dem Dichter aus Mäonien gleich oder doch am nächsten komme, lachte er und gab folgenden Orakelspruch: ‘Wenn einer geboren werden konnte, dem du, Homer, folgen musstest, dann wird es wohl einer sein, der dir, Homer, folgen kann.’“)
Von Vergil ist in diesem Gedicht – anders als in der Überschrift suggeriert – nicht ausdrücklich die Rede. Zunächst hat es den Anschein, dass im zweiten Distichon einer traditionellen Vorstellung vom schlechthin nicht zu imitierenden Homer, der auch selbst keine Vorgänger gehabt hat, das Wort geredet wird: „Wenn es jemanden gegeben hätte, den du nachahmen konntest, so wird es auch künftig jemanden geben, der dich nachahmen können wird.“ Velleius Paterculus hatte – ins Negative gewendet – über Homer eine entsprechende Anschauung formuliert: in quo <scil. poeta> hoc maximum est, quod neque ante illum, quem ipse imitaretur, neque post illum, qui eum imitari posset, inventus est (Vell. 1, 5, 2).10 Doch sind die Worte Apollos, ihrer Natur als Orakelspruch entsprechend, doppeldeutig. Den Schlüssel gibt die zweifache Bedeutung von sequi: Das Verbum kann einerseits – wie im Schlusssatz des oben zitierten Quintilianabschnitts der Fall – die Nachfolge hinsichtlich des Ranges bezeichnen, andererseits aber auch eine intentionale literarische Bezugnahme auf einen Modelltext.11 Im Fall von Anth. Lat. 713 2Riese liegt ein Wortspiel nach Art einer distinctio vor. Die zweite, verrätselte Gedichthälfte lässt sich nämlich auch folgendermaßen paraphrasieren: „Falls es möglich ist, dass du, Homer, einmal den zweiten Platz einnehmen musst, dann wird wohl einer geboren werden, der dich nachahmen kann.“12 Die imitatio ist demnach geradezu die Bedingung, um die Überbietung des kanonischen Modells zu erreichen. Delphische Orakelsprüche behalten in der Regel recht, und zwar gerade in dem Sinn, der sich nicht auf den ersten Blick hin erschließt: Das Gedicht plädiert demnach mit der Autorität des Musengottes für eine Vorrangstellung Vergils vor Homer.13
Die drei Gedichte14 weisen entgegen der von Quintilian ex cathedra verkündeten Rangfolge eine erhebliche Variabilität im Urteil und in der Perspektive auf: Selbstbewusste Verkündigung der Überbietungsabsicht durch Vergil selbst (Anth. Lat. 674a 2Riese), schulmäßige Bestenliste mit Homer an unhinterfragt erster Stelle (Anth. Lat. 740 2Riese), ironisches Spiel mit den Bedingungen und Möglichkeiten von imitatio und aemulatio (Anth. Lat. 713 2Riese). Ermöglicht wurde eine derartige Dynamik durch das Doppelprinzip von Natur und Kultur, von dem der zitierte Passus aus der Institutio oratoria ausgeht: Je nach Gewichtung und Verhältnisbestimmung der beiden Parameter konnte man damit ja entweder die prinzipielle Unerreichbarkeit Homers begründen oder eben die Möglichkeit einer Einholung der natura durch ars. Indem Quintilian die Einschätzung der beiden Dichter an zwei unterschiedliche Kriterien knüpfte, machte er sein Urteil von der Definition und Relation eben dieser Kriterien abhängig.
Der Name des Alcimus führt schließlich noch zu einem letzten Text, der in knapper Form einen Vergleich dreier Dichter bringt, und damit den literaturgeschichtlichen Horizont der bisher behandelten Gedichte erweitert (Anth. Lat. 225 Shackleton Bailey):15Anthologia Latina225 Sh.-B.
Mantua, da veniam, fama sacrata perenni: | sit fas Thessaliam post Simoenta legi.
(„Mantua, sei nachsichtig, du bist ja mit ewigem Ruhm gesegnet: Lass zu, dass man auch nach dem Simois über Thessalien liest.“)
Die drei geographischen Namen verweisen auf Vergil (Mantua), Lucan (Thessaliam) und Homer (Simoenta).16 Mit Bezug auf Lucan. 9, 980–98617 bittet der Sprecher – die fiktive persona Lucans oder der im neunten Buch der Pharsalia genannte Caesar, d.h. Nero? – bei Vergil darum, dass man auch das Bürgerkriegsepos nach einem Werk wie der Ilias noch lesen würde. Der Autor des Epigramms sah allem Anschein nach einen Widerspruch darin, dass sich Lucan im neunten Buch der Pharsalia auf den ewigen Ruhm Homers berufen, Vergil aber dabei mit keinem Wort erwähnt hatte. Die Bitte an Vergil – dem mit fama sacrata perenni bei Alcimus genau diejenige Qualität zugeschrieben wird, mit der Homer in Lucan. 9, 984 glänzt, nämlich ewiger Ruhm – soll diesen literaturkritischen faux pas Lucans ausgleichen: Neben Homer ist es für Alcimus eben auch Vergil, bei dem man mit seinem Wunsch nach ewigem Dichterruhm vorstellig werden muss.18
Zumindest zwei der vier Gedichte – Anth. Lat. 674a und 713 2Riese – behandeln den vorgegebenen Kanon also als eine verhandelbare Größe: Sie stellen das durch Quintilians Autorität verfestigte Urteil zur Disposition, wonach grundsätzlich Homer der erste, Vergil aber der zweite Rang zukommt, wobei auch beim letzten Gedicht (Anth. Lat. 225 Shackleton Bailey), in dem sich einer von den traditionell auf die hinteren Ränge verwiesenen Autoren zu Wort meldet, ein spielerischer Ton den Umgang mit den Vorgaben des Kanons bestimmt. Das einzige Gedicht, in dem der Kanon scheinbar uneingeschränkt affirmativ behandelt wird (Anth. Lat. 740 2Riese), lässt durch das pedantisch vorexerzierte Auszählen der Positionen ebenfalls eine gewisse Distanzierung zum Inhalt erkennen. Kanonisierung wird in diesen kurzen Stücken demnach einerseits als ein spielerischer Prozess des Aushandelns von Positionen vorgeführt, der seine besondere Dynamik andererseits aber in einem argumentativen Austausch konkurrierender Begründungen für die jeweilige Wertung entfaltet.
Das kann in einem Epigramm nur in pointierter Zuspitzung geschehen. Andere Zeugnisse antiker Literaturkritik, die im Zentrum der nachfolgenden Untersuchung stehen, tun dies in weit ausführlicherer und differenzierterer Form. Die Epigramme des Alcimus zeigen aber, dass man sich – zumindest in diesem Falle – von einer statischen Auffassung des Kanons zu lösen hat. Für Alcimus bzw. die personae seiner Gedichte besitzt der Kanon zwar Gültigkeit als ein allgemein bekannter kultureller Bezugspunkt. Die Gedichte formulieren aber alternative Sichtweisen und Perspektiven, sei es im Modus der Parodie (Anth. Lat. 740 2Riese), der Ethopoiie des unterlegenen Zweiten (Anth. Lat. 674a 2Riese), in der Doppeldeutigkeit eines Orakelspruches (Anth. Lat. 713 2Riese) oder in der nachgeholten Reverenz des „Dritten“ an den „Zweiten“ (Anth. Lat. 225 Shackleton Bailey). Man greift sicherlich zu hoch, wenn man diesen Gedichten die Absicht unterstellt, sie wollten den gültigen Kanon subversiv infrage stellen oder generell „Kanonkritik“ betreiben. Vielmehr geht es um einen produktiven und differenzierenden