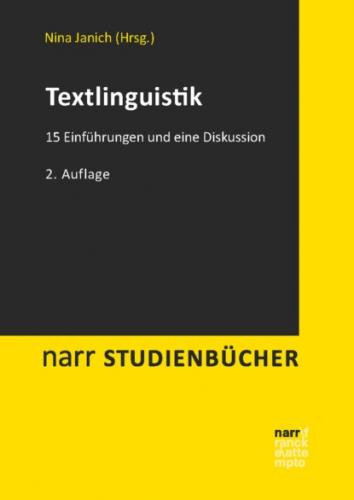Die RST bietet einen Ansatz zur Beschreibung von satzübergreifenden Textkohärenzen zwischen größeren Texteinheiten aus ganzen Satzfolgen. Dies stellt eine Erweiterung gegenüber einer einfachen Theorie propositionaler Verknüpfungen dar, in der lediglich Paare direkt aufeinanderfolgender Sätze betrachtet werden. Gemäß der RST kann jeder Komplex von Texteinheiten, der durch eine Textbeziehung zu einer Textstruktur verbunden ist, selbst wieder Teil einer Textbeziehung sein. Texteinheiten aus mehreren Sätzen können also in der gleichen Weise wie einzelne Sätze als Elemente von Textbeziehungen fungieren. Eine Begründung zu einer Aussage etwa muss nicht aus einem einzelnen Satz bestehen, sondern kann selbst wieder eine ganze, in sich strukturierte Satzfolge darstellen. Dabei gelten stets die gleichen allgemeinen Strukturbedingungen zwischen den Texteinheiten, gleichgültig ob es sich um einzelne Sätze oder ganze Satzgruppen handelt: Alle Texteinheiten können durch genau eine Textbeziehung mit einer benachbarten Texteinheit zu einer Texteinheit auf einer höheren Ebene verbunden werden; es gibt weder Überlappungen noch Textbeziehungen über Distanz noch mehrfache Zuordnungen einer Texteinheit zu anderen Texteinheiten. Unter diesen Annahmen kann man einen Text vollständig als Baumstruktur analysieren, als sukzessive Verknüpfung von Texteinheiten in einer hierarchischen Strukturierung. Die Rhetorical Structure TheoryRhetorical Structure Theory wird in Kap. 15 näher erläutert, dort findet sich auch eine Beispielanalyse (siehe 15.3.3).
4.5 Text als Entfaltung einer Kernidee
Ein anderer Ansatz, die Kohärenz zwischen längeren Satzfolgen zu erklären, basiert auf dem Grundgedanken, dass einem Textabschnitt eine Art Hauptgedanke, eine Kernidee zugrunde liegt, die dann in den einzelnen Sätzen konkretisiert und ausformuliert wird. Ein Text wie der in Abschnitt 4.2.2 zitierte (Beispiel (4–8)) hat unbestreitbar eine Einheitlichkeit, auch wenn er keine wörtlichen Isotopien zwischen einzelnen Nominalgruppen aufweist:
(4–10) Silberne Wasser brausten, süße Waldvögel zwitscherten, die Herdenglöcklein läuteten, die mannigfaltig grünen Bäume wurden von der Sonne goldig angestrahlt.
Im Alltagsverständnis kann man sagen: Die Kohärenz dieses Textes liegt darin, dass in ihm eine allgemeine Grundidee ausformuliert wird. Der Bezug aller Sätze auf einen solchen Grundgedanken macht die Kohärenz des Textes aus.
Dieser Gedanke ist etwa im Text-Thema-ModellText-Thema-Modell von Erhard Agricola (Agricola 1976, 1977, 1979, s.u.) ausgearbeitet worden. Agricola (1976: 15) definiert das THEMA eines Textes als „begrifflichen Kern im Sinne der konzentrierten Abstraktion des gesamten Textinhaltes“; in der Kleinen Enzyklopädie (1983: 221) wird das Thema eines Textes umschrieben als „ein Grund- oder Leitgedanke, der die wesentlichen inhalts- und strukturbestimmenden Informationen des Gesamttextes in konzentrierter, abstrakter Form enthält“. Ähnlich umschreibt Brinker (62005: 55ff.) das Thema eines Textes als „Grund- oder Leitgedanken eines Textes“, als „Kern des Textinhalts“, als „die größtmögliche Kurzfassung des Textinhalts“; der Text ist die „Entfaltung des Themas“. Brinker geht dabei von vier Arten der THEMENENTFALTUNGThemenentfaltung aus:
DESKRIPTIVE THEMENENTFALTUNG: Ein Thema wird in seine Teilthemen zerlegt und in räumliche und zeitliche Umstände eingeordnet. Typische Textsorten sind z.B. Nachricht, Lexikonartikel und Bericht.
EXPLIKATIVE THEMENENTFALTUNG: Ein Sachverhalt wird aus einem oder mehreren anderen Sachverhalten abgeleitet. Typische Textsorten sind z.B. Lehrbuchtexte, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Darstellungen.
ARGUMENTATIVE THEMENENTFALTUNG: Auf der Textoberfläche sind Thesen und die Entwicklung von Argumenten für diese Thesen präsent. Die Stützung der Argumentation kann implizit erfolgen. Typische Textsorten sind z.B. Politikerreden und Gerichtsreden.
NARRATIVE THEMENENTFALTUNG: Sie ist typisch für Alltagserzählungen und wird dann gebraucht, wenn ein abgeschlossenes Ereignis mit einem bestimmten Neuigkeits- oder Interessantheitswert dargestellt werden soll.
In der Regel hat ein Text nicht nur ein einziges Thema (und weist auch nicht nur eine Form der ThemenentfaltungThemenentfaltungEntfaltung, thematischeThemenentfaltung auf), vielmehr sind Texte mehrschichtig, hierarchisch aufgebaut: Kleinere Textabschnitte sind durch ein TEILTHEMATeilthemaThemaTeilthema oder SUBTHEMASubthemaThemaSubthema zusammenfassbar, mehrere Teilthemen/Subthemen können wiederum zu größeren Teilthemen zusammengefasst werden usw. bis zur obersten Ebene, auf der alle Teilthemen zum Gesamtthema des gesamten Textes zusammengeführt werden. Das lässt sich an der schematischen Darstellung der thematischen Struktur eines Berichts über einen Wohnungsbrands veranschaulichen (Brinker 62005: 63):
(4–11) (1) Gegen 15 Uhr wurde gestern die Aachener Berufsfeuerwehr alarmiert. (2) Sie rückte in die Thomashofstraße aus, wo es in einer Wohnung brannte. (3) Die Feuerwehrleute löschten mit drei C-Rohren. (4) Oberbrandrat Starke war ebenfalls am Einsatzort. (5) Zwei Zimmer brannten vollkommen aus. (6) Drei weitere wurden in Mitleidenschaft gezogen. (7) Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. (8) Die Kripo hat sich inzwischen eingeschaltet. (9) Die Feuerwehrleute mussten aus einem oberen Geschoß ein Kleinkind retten. (10) Während des Brandes befand sich niemand in der heimgesuchten Wohnung.
Diesem Text lässt sich nach Brinker eine thematische Struktur wie die folgende zuschreiben:
Thematische Struktur des Beispieltextes (4–15) (Brinker 62005:63)
Das Beispiel zeigt im Übrigen, dass im vorliegenden Fall die lineare Struktur der logischen Struktur nicht ganz entspricht. (Dies ist hier durch die übliche „Pyramidenstruktur“ von Zeitungsmeldungen verursacht, wonach das Wichtigste vorangestellt wird und Details am Ende nachgeschickt werden.)
Nur äußerlich anders kommt das Makrostruktur-KonzeptMakrostruktur-Konzept von van Dijk (1980: 41–67) daher. Satzsequenzen können nach van Dijk in so genannten MAKRO-STRUKTURENMakrostruktur zusammengefasst werden. Makrostrukturen entsprechen für van Dijk (1980: 45) Textthemen im Sinne von Brinker oder Agricola; sie stellen eine Art abstrahierende, verallgemeinerte Zusammenfassungen solcher Satzsequenzen dar. Die MakrostrukturenMakrostruktur können wieder zu übergeordneten Makrostrukturen zusammengefasst werden. Auch hier ergeben sich durch die sukzessiven Schritte des Zusammenfassens („Zusammenfassungen von Zusammenfassungen“) baumartige Inhaltsstrukturen.
Gemeinsam ist all diesen Ansätzen, dass die übergeordneten Zwischenelemente, seien sie Thema oder Makrostrukturen, grundsätzlich selbst wiederum Propositionen oder Sätze sind, also sprachliche Elemente der gleichen Art wie die zusammengefassten Texteinheiten. Sie können dementsprechend im Text selbst als gewöhnliche Sätze erscheinen, als Kurzzusammenfassung, Überschrift oder Einleitung. Explizite Ausformulierungen im Text sind allerdings nicht notwendig, der Kerninhalt kann auch nur implizit im Text verborgen bleiben und muss sprachlich nicht manifest werden.
Die Komplexität dieser Frage wird auch an