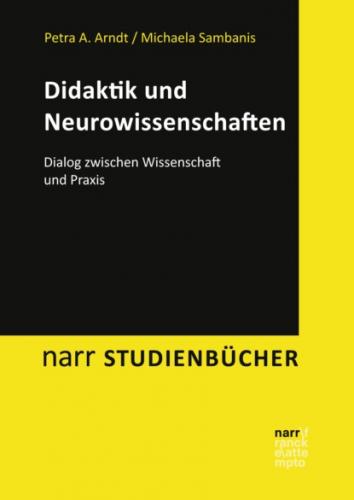Bei dem Versuch, mögliche Antworten auf die Frage nach Konsequenzen für die Praxis zu finden, werden sich neue Fragen ergeben und mit ihnen der Wunsch, diese so beantworten zu können, dass auch sie zu einer „evidence-informed practice“ (Nevo & Slonim-Nevo 2011) beitragen können. Dies verweist auf die Prozessualität des gesamten Unterfangens: Evidenzbasierte Didaktik kann nicht statisch sein. Sie speist sich aus Forschungsfeldern, die sich durch Dynamik auszeichnen. Sie kann daher nicht beanspruchen, eine Art unerschütterlicher Heilslehre zu vermitteln.
Ein zeitgemäßes Verständnis von einer sich auch auf Erkenntisse der Neurowissenschaften stützenden Didaktik bedarf eines Weiterdenkens und teilweise auch Ablegens dessen, was gemeinhin mit dem Begriff NeurodidaktikNeurodidaktik assoziiert wird, nämlich, auf eine einfache Formel gebracht, das Ziehen von Schlussfolgerungen aus Befunden der Neurowissenschaften, oftmals ohne vorherige Auseinandersetzung mit möglichen Vorgehensweisen und ohne bewusste Entscheidung für ein Prozedere. Das eher intuitive und vor allem rein lineare Übertragen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, z.B. in die „Pädagogik als Anwendungsfeld“ (Müller 2009: 56), scheint zu kurz zu greifen und wird schon Ende der 1990er-Jahre in dem vielzitierten Artikel von Bruer (1997: 5) als „a bridge too far“ bezeichnet.
Seit einiger Zeit wird zum Umdenken aufgefordert: „knowledge needs to go in both directions“ (The Royal Society 2011: 18, kursiv im Original). Daraus ergibt sich beim Verbinden von Neurowissenschaften und Didaktik die Aufgabe, sich von dem linearen Modell zu lösen, den Blick zu erweitern, d.h., wie oben erwähnt, den Versuch zu unternehmen, Knotenpunkte im Wissensstand herzustellen. Anstelle einer einspurigen Kommunikationsführung, bei der die Gehirnforschung ihre Befunde anderen Disziplinen vermittelt, sollte es die NeurodidaktikNeurodidaktik als ihre Aufgabe verstehen, den Dialog zwischen den Neurowissenschaften, der Didaktik, Psychologie und Erziehungswissenschaft sowie zwischen Wissenschaft und Praxis anzuregen, weiter zu befördern und zu moderieren:3
[…] when asking how neuroscience can be useful to education it is insufficient to focus solely on our current understanding of brain function. Efforts to make change may be wasted if they are not accompanied by a reflection on how the translational process can be efficiently organized. (Sigman et al. 2014: 500)
Um darstellen zu können, wo sich der vorliegende Band verortet und wie versucht wird, den translationalen, reflektierenden und vermittelnden Auftrag zu erfüllen, werden im Folgenden zunächst kurz bisherige Entwicklungsströmungen und mögliche Positionen im Feld der bisherigen NeurodidaktikNeurodidaktik umrissen und vor diesem Hintergrund eine Positionierung vorgenommen.
1.1 RezeptionRezeption von Gehirnforschung
In seinem Beitrag zu pädagogischen Implikationen der Hirnforschung stellt Müller (2005) systematisch dar, wer zu den Rezipienten der Neurowissenschaften zählt, warum und wie die Befunde der Hirnforschung jeweils rezipiert wurden bzw. werden. Im Folgenden sollen einige wichtige Entwicklungen nachgezeichnet und in Orientierung an der von Müller vorgelegten Unterscheidung dreier Rezeptionsmuster dargestellt werden.
Die Analyse der Art und Weise, wie die Schulpädagogik, die Didaktik – streng genommen müsste man von Allgemeiner Didaktik und den einzelnen Fachdidaktiken sprechen (vgl. Arnold & Roßa 2012: 11ff.) – und die Allgemeine Erziehungswissenschaft, ursprünglich vor allem zum Zwecke der „empirische[n] Abstützung radikal-konstruktivistischer Konzeptionen“ (Müller 2005: 71), neurowissenschaftliche Befunde rezipiert haben, erlaubt die Identifikation dreier möglicher Rezeptionsmuster: die kritische Begrenzung und DistanzierungDistanzierung, die direkte Aufnahme und die kritische Übersetzung (vgl. Müller 2005: 73). Während Letztere noch weitgehend als Entwicklungsaufgabe zu betrachten ist, sind die beiden erstgenannten Rezeptionsmuster seit einigen Jahren existent und gut voneinander abgrenzbar.
1.1.1 DistanzierungDistanzierung
In den o.g. Disziplinen sowie in weiteren finden sich Vertreterinnen und Vertreter, die den Neurowissenschaften skeptisch bis verschlossen gegenüber stehen.1 Der Wert, teils auch die Aussagekraft und Finalität (vgl. Schirp 2003: 304) oder Genauigkeit neurowissenschaftlicher Studien wird von ihnen infrage gestellt. Oftmals wird die Relevanz der eigenen Disziplin für die Erkenntnisgewinnung hervorgehoben und argumentiert, dass die Hirnforschung keine Erkenntnisse erbrächte, die nicht durch Studien innerhalb der eigenen Domäne mit mindestens ebenso hoher Genauigkeit und Aussagekraft zu erreichen seien. Ein Vertreter dieser Argumentationslinie ist der Psychologe Bowers (2015), der im Zuge seiner die Meriten der experimentellen Psychologie unterstreichenden Argumentation feststellt, dass „understanding the brain […] irrelevant to designing and assessing teaching strategies“ (Bowers 2015: 601) sei. Er begründet seine Distanznahme u.a. dadurch, dass aus seiner Sicht die Hirnforschung zum Feld der education nichts beizutragen habe, „above and beyond what psychology has already established“ (Bowers 2015: 602) oder jenseits dessen, was die Erziehungswissenschaft und Pädagogik2 sowie jede erfahrene Praktikerin und jeder erfahrene Praktiker ohnehin schon längst wisse (vgl. Schirp 2003: 304).
Oft bestätigen neurowissenschaftliche Erkenntnisse die von anderen Disziplinen generierten Befunde bzw. von Praktikerinnen und Praktikern gewonnene Erfahrungen. Von Neuro-SkeptikerNeuro-Skeptikern wird die Bestätigung auf neurowissenschaftlichem Weg als obsolet betrachtet und nicht als eine Verdichtung des Kenntnisstandes beurteilt (vgl. z.B. Bowers 2015: 603). Der „Tendenz nach betrachtet man Hirnforschung als eine Gefahr“ (Müller 2005: 91) für das eigene wissenschaftliche Fachgebiet, dessen Eigenständigkeit und Relevanz. Aus manchen neuro-skeptischen Argumentationen spricht die Sorge, mit der eigenen Disziplin in den Schatten einer populären und zudem noch sehr medientauglichen Wissenschaft zu geraten.3
Die große Popularität der Neurowissenschaften (vgl. u.a. Becker 2006, Heinemann 2012) seit der durch den Senat der USA ausgerufenen Decade of the Brain (1990–2000), gefolgt von der Decade of the Mind (vgl. Sambanis 2015: 153), bricht zwar trotz neuro-skeptischer Stimmen nicht ein, aber in letzter Zeit kann ein gewisser Rückgang des Interesses bzw. der Akzeptanz beobachtet werden. Dafür scheinen zwei Gründe maßgeblich zu sein: zum einen die (Omni-)Präsenz der Neurowissenschaften bis hinein in die Alltagswelt, die nach der anfänglichen, durch die Entdeckung der bildgebenden Verfahren ausgelösten Faszination zu einer Sättigung oder gar Übersättigung geführt hat und zum anderen die Kritik an der bisweilen zweifelhaften Art der Übertragung von Erkenntnissen bzw. an den Neurowissenschaften selbst.4
Die Neurowissenschaften entwickelten sich seit den 1990ern zu einer „populäre(n) Wissenschaft“ (Heinemann 2012: 42), die in viele Forschungs- und auch Lebensbereiche hineindrängte bzw. hinzugezogen wurde: Hirnforschung und Rechtsprechung (Haben wir einen freien Willen und wo zeigt er sich?), Hirnforschung und Religion (Warum sind gläubige Menschen resilienter?), Hirnforschung und Partnersuche (Partnerwahl mit Hirnscan?), Neurogastronomie (Können durch Aromen biochemische Prozesse ausgelöst und z.B. Stimmungen beeinflusst werden?) und natürlich gehirngerechtes Lernen –