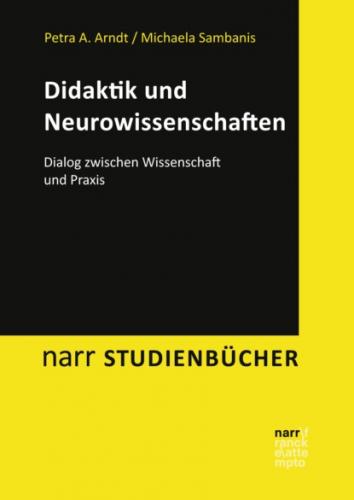Betrachtet man das Verhalten von Jugendlichen genauer und untersucht es in experimentellen Studien, dann stellt man fest, dass die kognitiven Funktionen nicht durch pubertäre Vorgänge beeinträchtigt werden. Ganz im Gegenteil schreitet die Entwicklung auch in der Jugendzeit weiter voran und führt zu einer Verbesserung der kognitiven Leistungen (vgl. Geier 2013). Die Ursachen für die auftretenden Verhaltensänderungen liegen zu einem großen Teil im emotionalen und motivationalen Bereich (Smith, Chein & Steinberg 2013). EmotionenEmotion und motivationale Faktoren beeinflussen die kognitive Kontrolle, also die bewusste Kontrolle von Handlungen, aber auch von Denkmustern, während der AdoleszenzAdoleszenz stärker als vor und nach dieser Phase. Die zugrunde liegenden Faktoren sind zunächst einmal hormoneller Natur. Die während der PubertätPubertät ausgeschütteten Geschlechtshormone wirken bekanntermaßen auf viele Prozesse im ganzen Körper; die Wirkung auf das Nervensystem ist nur eine darunter. Die Geschlechtshormone beeinflussen die Übertragung von Informationen zwischen den NervenzellenNervenzellen ebenso wie bestimmte Wachstumsprozesse im Gehirn. Die Rezeptoren, über die die HormoneHormone ihre Wirkung entfalten, befinden sich vor allen Dingen in eben den Regionen, die mit der Verarbeitung von Emotionen und mit MotivationMotivation zusammenhängen (vgl. Abb. 4): in subkortikalen Strukturen wie der AmygdalaAmygdala (Angst und emotionale LernprozesseLernprozesse), dem HippocampusHippocampus (Lernen und Verarbeitung emotionaler Reize), dem Nucleus accumbensNucleus accumbens (Erwartung von BelohnungBelohnung und positiven Gefühlen) und zudem im Frontalhirn (Planung, Handlungskontrolle, vgl. Ahmed, Bittencourt-Hewitt & Sebastian 2015).
Die Auswirkungen der Veränderungen im Gehirn finden sich zum einen im emotionalen und sozialen Bereich, u.a. in Veränderungen der Beziehungen zu Gleichaltrigen und zu Erwachsenen und zum anderen in Handlungsplanung und vorausschauendem Verhalten. Zu beiden Bereichen gibt es eine Vielzahl an Studien, von denen hier nur einige wenige genannt werden können.
Im Bereich der Handlungssteuerung entstehen Veränderungen des bisherigen Verhaltens dadurch, dass Jugendliche Versuchungen nur schlecht widerstehen können (vgl. Steinberg 2008). Gehirnbereiche, die auf emotional anziehende und „Spaß machende“ Reize reagieren, befinden sich in einer Phase des Wachstums und der steigenden Aktivität. Hirngebiete, die auch bei Erwachsenen auf erstrebenswerte Objekte oder zu erwartende angenehme Zustände reagieren, zeigen bei Jugendlichen verstärkte Reaktionen (vgl. Somerville, Jones & Casey 2010). Der biologische Sinn dessen ist, dass Heranwachsende stärker auf mögliche Sexualpartner reagieren (um sich möglichst früh „den besten Partner zu angeln“) oder auch auf geeignete Beute, leckere Früchte usw. Immerhin werden sie später eine Familie zu ernähren haben und man muss die guten Techniken, um Beute zu jagen und Früchte aus dem Baum zu holen, ja rechtzeitig üben. Dass wir inzwischen nicht mehr als Jäger und Sammler leben, sondern in einer Welt, in der auf der einen Seite langfristige Ziele anzustreben sind und die in widersprüchlicher Weise auf der anderen Seite voller verlockender Versuchungen ist, ist von der Natur nicht vorgesehen. Aufgrund der Hirnprozesse, die durchaus einmal ihren Sinn hatten, gelingt es jungen Menschen z.B. nicht gut, BelohnungenBelohnung aufzuschieben, um ein wichtigeres und erstrebenswerteres Ziel zu erreichen. Vielmehr tendieren sie dazu, sich einem attraktiven Objekt oder einer angenehmen Tätigkeit oder sonstigen Belohnung sofort zuzuwenden, selbst wenn das auf lange Sicht nicht vorteilhaft ist. In Experimenten neigen Jugendliche beispielsweise viel stärker als Erwachsene zu riskanten Wetteinsätzen, wenn sie den Gewinn sofort erhalten. Die hohe Affinität zu positiven, belohnenden Objekten und Situationen bringt Jugendliche dazu, auch sehr riskantes Verhalten im Alltag zu akzeptieren, wenn eine Belohnung in Aussicht gestellt ist (vgl. Geier 2013) – manchmal genügt dafür bereits die bewundernde Anerkennung der Freunde (vgl. Steinberg 2005, Sambanis 2013). Das erklärt das vermehrte Auftreten von übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum, ungeschütztem Sex (bei dem die HormoneHormone selbstverständlich großen Anteil haben), Todesfällen durch allzu riskante sportliche Manöver, Mutproben und anderen lebensgefährlichen Aktivitäten – wobei es selbstverständlich erhebliche individuelle Unterschiede gibt. Diese spiegeln sich auch in der VernetzungVernetzung innerhalb des Gehirns von Jugendlichen: Im erwachsenen Gehirn hat der präfrontale Cortexpräfrontaler Cortex eine inhibitorische, also hemmende Verbindung zum limbischen System, welches die emotionalen Reaktionen auslöst. Je stärker diese Verbindung bereits bei Jugendlichen ist, umso stärker ist die Selbstkontrolle der jungen Menschen und umso später bzw. seltener fangen sie an, Drogen und Alkohol zu konsumieren (vgl. Lee & Telzer 2016).
In Bezug auf die emotionale Entwicklung werden Emotionswahrnehmung und EmotionsEmotionregulation als zentrale Bereiche der Veränderung diskutiert (vgl. Böttger & Sambanis 2017: 68ff.). Um Emotionen regulieren zu können, müssen emotionale Signale (eigene und die anderer) und die Notwendigkeit, auftretende Emotionen zu regulieren, erkannt werden und es bedarf einer Strategie, die diese RegulationRegulation ermöglicht (vgl. Sheppes, Suri & Gross 2015). Bereits bei der Emotionswahrnehmung gibt es Einschränkungen in der Zeit der PubertätPubertät. Teenager haben vorübergehend mehr Probleme als vorpubertäre Kinder und als Erwachsene, den emotionalen Ausdruck in Gesichtern oder auch den emotionalen Gehalt von Wörtern schnell zu erkennen (vgl. McGivern, Andersen et al. 2002). Die Korrektheit, mit der ein emotionaler Ausdruck erkannt wird, steigt aber mit dem Alter an, ist also bei Jugendlichen je nach ausgedrückter Emotion ebenso gut oder besser als bei Kindern, aber noch nicht so gut wie bei Erwachsenen. Am ehesten bereitet es Jugendlichen noch Probleme, den Unterschied zwischen AngstAngst und Wut zu erkennen. Zudem gibt es Geschlechtsunterschiede: Insgesamt erkennen Mädchen Emotionen zuverlässiger als Jungen.
Mit dem Einsetzen der AdoleszenzAdoleszenz steigt die Sensitivität für soziale Erfahrungen (vgl. Blakemore & Mills 2014). Diese erhöhte Sensitivität ist eine Voraussetzung dafür, die mit dem Erwachsenwerden verbundenen Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, nämlich einen anderen, reifen Umgang mit anderen Menschen zu entwickeln, also andere Arten sozialer Beziehungen zu knüpfen und zudem das eigene SelbstkonzeptSelbstkonzept als erwachsene Person zu entwickeln (vgl. Sebastian, Burnett & Blakemore 2008). Auch hierbei spielen die PeergroupPeergroup und weitere soziale Beziehungen eine wichtige Rolle. Die Bedeutsamkeit, die die (angenommene) Meinung Gleichaltriger für die Entwicklung des jugendlichen Selbstkonzepts hat, lässt sich sogar hirnphysiologisch nachweisen: Beschäftigen sich Jugendliche mit dem Bild, das Freunde von ihnen und ihren Eigenschaften haben, so sind mehr und andere Hirnstrukturen aktiv als bei Erwachsenen (vgl. Jankowski et al. 2014). Unter anderem ist auch das Belohnungszentrum aktiv, was die hohe Wichtigkeit der Meinung anderer deutlich widerspiegelt (zur Rolle der Peergroup in der Jugend vgl. Böttger & Sambanis 2017: 25ff.).
Mit der Sensitivität steigt allerdings auch die emotionale Anfälligkeit (vgl. Nelson & Guyer 2011). In der AdoleszenzAdoleszenz treten vermehrt psychische Probleme auf, sowohl internalisierende Probleme wie Angststörungen und Depressionen, als auch externalisierende Störungen wie antisoziales Verhalten (vgl. Lee et al. 2014, Paus et al. 2008, Powers & Casey 2015). Angesichts der starken Veränderungen im Gehirn, die mit hoher Flexibilität, aber auch mit erhöhter StöranfälligkeitStöranfälligkeit verbunden sind, kann das nicht verwundern (vgl. 2.5.1). In einem Review zur Entwicklung von Jugendlichen beschreiben Schriber & Guyer (2016) die Licht- und Schattenseiten der hohen Flexibilität. Ausgehend davon, dass die Beeinflussbarkeit durch die Umgebung – auch aufgrund neurobiologischer