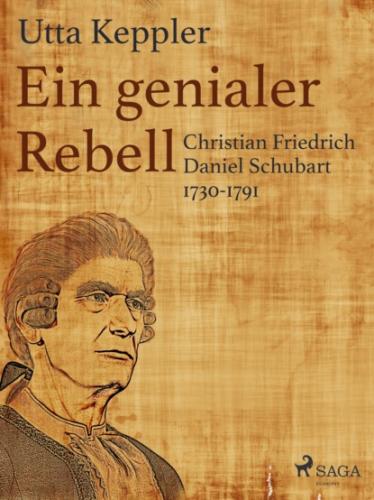Im Hof bestieg die „Dame“ ihre Karosse. Schubart saß auf dem Bock beim Kutscher. Ein Stück weiter, im Park wartete ein zweiter kleinerer Wagen, Casanova stieg wortlos um. Er winkte flüchtig aus dem Fenster des Gefährts, das ihn – Gott wußte, wohin – in die Dunkelheit entführte.
Schubart, zitternd vor Spannung, mußte jetzt an seine geschmolzene Barschaft denken. Ob er bezahlt sei, fragte er den Kutscher, und wie weit er ihn mitnehmen könne? Das sei erledigt, antwortete der Mann neben ihm, und er werde ihn am Eßlinger Tor absetzen. Nicht weit davon lag Schubarts dürftiges Quartier. Erschöpft, als habe er Schlachten geschlagen, schlief er in der Nacht. Am nächsten Tag gingen Gerüchte um, die ihn vorsichtig machten. Es hieß, man habe im Gefängnis des Seigneur de Saintgalt eine Dame gefunden, die sich als Lady ausgebe. Sie sei, wie sie versichere, von dem berüchtigten Abenteurer aufs übelste mißhandelt worden, schließlich habe er sie hilflos auf dem Stroh liegen lassen und sich davongemacht. Daß sie eine Lady sei, glaubte man ihr freilich nicht, aber die sie kannten, schwiegen lieber. So wurde die Jetterin frei, fuhr heim und lachte. Der betrogene Wächter wurde bestraft, obwohl er mit heiligen Eiden beschwor, daß Tür und Tor unpassierbar gewesen seien. Casanova verfolgte man nicht – er hatte Gönner am Hof.
Schubart war allein. Den Drollinger war er los, leider, denn er war ein guter Kerl gewesen.
Das Liesele in der Hofküche und die Gretel am Markt und die Hanne im Wirtshaus – der junge Mann hatte in Stuttgart viele Bekanntschaften gemacht und manche Freundschaft geschlossen, und als er nach Nürnberg kam, trieb er’s so weiter. Es waren dumme, naive und raffinierte Geschöpfe darunter und er – ein Bursche von siebzehn Jahren, noch fast ganz unerfahren und recht gutgläubig, erwartete von jeder die Offenbarung und Erlösung, bis er allmählich stumpfer wurde und leichtfertiger mit den Mädchen umging. Er tröstete sein pietistisch geschliffenes Gewissen mit der Dichtermoral, die er sich vorsagte, und flog hin und her, bis ihn der Vater, ernstlich besorgt, heimrief und zum Studium der Theologie in Jena bestimmte. Sehr begierig war der junge Schubart freilich nicht auf das Studium, denn er bemerkte altklug, daß die hohe Schule weder den Weisen noch den genialsten Mann schaffe, man könne wohl beides sein, ohne je eine Universität gesehen zu haben. Nun tat er sich zunächst in der Heimat um, besuchte den Lauterburger Pfarrer Schuler, der wie viele Zeitgenossen die Himmelskunde betrieb, „Gläser schliff und Sehrohre machte“, und versuchte sich selber in der Astronomie, wie er alles ergriff, was es Neues und Interessantes in seiner Umgebung gab, wißbegierig und aufnahmebereit.
Im Herbst 1758 reiste er, bepackt mit Büchern, Wäsche, Würsten und Bouteillen und nicht minder mit Ratschlägen und Verboten, nach Jena ab. Aber unterwegs, in Erlangen, hielten ihn die sangeslustigen Genossen und ein paar hübsche Mädchen fest, er warf sich unternehmend ins Gewirbel des Burschenlebens, ein trink- und musikfreudiger Mensch und rede- und versgewandter Gesellschafter, ohne weiter zu denken, als wie er mit den schwärmenden Freunden Tage und Nächte „hinbrausen“ könnte. Dazwischen studierte er „tumultuarisch“, wie er es später reuevoll nannte, alles durcheinander; Systeme waren nie seine Stärke und niemand hatte ihn je angewiesen, sich zu beschränken, einzuteilen, zu wählen, wie es für eine „seriöse Bildung“ nötig gewesen wäre.
Da verklagte ihn sein Hauswirt wegen der Mietschulden, der Weinschenk wegen der Kreide für viele unbezahlte Bouteillen und einige Väter wegen den Umtrieben mit ihren Töchtern; er schrieb nach Hause, er sei ein zitternd halbverhungertes Opfer seines Übereifers in Theologiae und einiger böswilliger Verleumder, doch der Dekan in Aalen reagierte unerfreulich: Der Herr Sohn habe denen großen Opfern derer eingeschränkten Eltern zu gedenken und sich entsprechend eifrig seines Studiums zu befleißigen, da man ihm sonst den Wechsel sperren würde.
Aber zu dieser Umkehr war es zu spät. Als er nachts heimkam, wartete der Stadtbüttel; er saß mürrisch und mit dem Schlaf kämpfend auf der Stiege, Der Herr sei verhaftet und habe unverzüglich ins Stadtgefängnis mitzugehen, „keine Widerrede, Herr Studiosus“.
Der weinselige Schubart taumelte in der kühlen Nacht, schlich vor dem Büttel in sein Verlies – sein erstes, wenn man den Besuch bei Casanova nicht rechnen wollte, und kroch zerknirscht in eine Mauerecke. Was die zu Hause denken würden, und die Freunde und die Mädchen? Und – die Professoren? Aber er hatte keine Protektion und keine Damen zur Seite, die ihn freimachten wie den Casanova; er mußte brummen.
Man hielt ihn ordentlich, gab ihm gut zu essen, da es ja um Kavaliersdelikte ging, um Spiel- und Trinkschulden eines Studenten, aber herauskommen würde er kaum, ehe der Vater zahlte.
Ein paar Tage dämmerte er bekümmert hin, danach erwachte die alte ruhmredige Lust am Leben und dem eigenen Genie, er verlangte Feder und Papier und einen Boten, der sein Geschreibe forttrage. Eine gestickte Weste gefiel seinem Wächter, und mit ihr erkaufte Schubart sich auch den Besuch eines Freundes, der einen Korb Flaschen mitschleppte; dann wurden es mehr Besuche und auch Giovanetta wurde hereingeschoben, seine italienische Freundin, die hübsche sizilianische Liedchen singen konnte.
Als endlich ein zorniges Schreiben und – „um der Schande willen“ – ein Guldenbetrag von Aalen kam, ließ sich der Wärter erbitten, ein altes Klavier hereinzuschaffen, das dem Kommissar, einem ehemaligen Gastwirt, gehörte.
Jetzt sah Schubart keinen Grund mehr, sich zu grämen: Er gab „Konzerte“ mit der Giovanetta, spielte, komponierte und „wütete in die Saiten“, trank, lärmte mit den Freunden, und lebte zudem umsonst auf Staatskosten – bis ihn der Bruder Conrad, Student der Rechte, unverhofft besuchte, und hinter ihm, schrecklich genug, das ernste magere Gesicht des Vaters auftauchte.
Indessen war er von der Hohen Schule relegiert worden, der Vater ließ letzte erborgte Gulden zurück, bis die Haft abgesessen sei, und Schubart kämpfte mit einem Fieber, das ihm sein unmäßiges Leben eingetragen hatte. Einer seiner Lehrer, der sein musikalisches Talent kannte, erwirkte endlich mit eigenen Opfern die Freilassung.
Schubart kam heim, nach Aalen, ins stille wohlgeregelte Dekanat, ohne Examen, ohne irgendein Zeugnis seines Fleißes, ohne Geld und – krank. Der Vater sprach nicht mit ihm, die Mutter weinte, die Brüder, so oft sie nach Hause kamen, mieden ihn ärgerlich.
Und ihm schwirrte der Kopf, Fieber und wilde Ideen trieben ihn um, der Medikus kurierte weniger, als er ihn kujonierteg, da er den Kummer des Dekans sah. Schubart hielt sich brav, er spürte die fragenden Blicke seiner Mutter, und die gingen ihm näher als des Vaters steinerne Miene. Er stand am Vormittag auf, die Abstinenz von Wein und Umtrieb fiel ihm schwer. Unlustig stocherte er im Essen herum, das die Magd fett und mehlreich gekocht hatte; gegen Abend lief er in die Wälder; jetzt, im Frühling lagen sie rotbraun knospend, voller Erwartung unter dem hellen Himmel; aus dem starkduftenden Boden stießen Grasspitzen und aus den schmalen Zweigen gelbgrüne Knospen, die Berghänge schwangen sich am Horizont hin, hauchzart gezeichnet, in der Ferne immer blasser und unbestimmter schwebend, wie eingesogen und aufgeschlürft von dem Wind, der die nahen Bäume wiegte und schaukelte. Schubart hatte eine Predigt des Vaters mitanhören müssen, ungern genug setzte er sich den unverhohlen feindlichen Blicken der Honoratioren aus, paßte nicht recht auf, da er sich über die nüchternen gradlinigen Gedanken des Alten erhaben dünkte, und wußte doch, daß es um die „herrliche Freiheit der Kinder Gottes“ ging.
Jetzt, im zunehmenden Abendwind, dachte er daran: Freiheit! Klopstock sang davon: „O Freiheit, Silberton dem Ohre, / Licht dem Verstand und hohes Glück zu denken, / dem Herzen groß Gefühl…“ –
Freiheit – das ist mein Grundklang, Freiheit, die Freiheit vom Zwange; „Kinder Gottes“, das verpflichtet, und ich will nicht, will nicht eingeschworen sein auf irgend etwas; ist der Wind da angebunden? Die Zweige? Wolken und Vögel? – Menschen allein zwingen einen ins Joch, das ich nicht mag.
Es wurde langsam dunkler, Umrisse verschwammen, Farben bräunten sich, der Himmel ließ noch ein paar schmächtige Streifen rot aufscheinen, dann zog sich der unsichtige Vorhang zu.
Schubart trabte heim, den Mauern zu. – Freiheit, Freiheit, dachte er auf einmal,