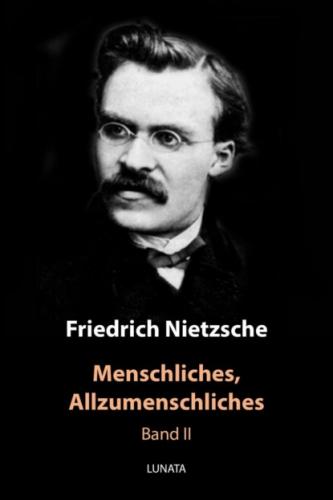LUNATA
Menschliches, Allzumenschliches
Zweiter Band
© 1880 Friedrich Wilhelm Nietzsche
Überarbeitete Neuauflage
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Einleitung
Die beiden vorliegenden Schriften samt dem letzten Abschnitt aus dem Nachlass sind in den Zwischenzeiten von meines Bruders trübstem Gesundheitszustand geschrieben. Schon im Frühjahr 1878, nach der Vollendung des I. Bandes von Menschliches, Allzumenschliches hatte er den Entschluss gefaßt, seine Professur an der Universität Basel aufzugeben; aber beide Freunde, Erwin Rohde sowohl als Karl von Gersdorff, legten so eifrig direkt und indirekt durch Andere gegen diesen Entschluss Protest ein, daß er sich noch einmal überreden ließ, in seinem Amte zu verbleiben. Auch begann er das Sommersemester 1878, nachdem er sich vier Wochen in Baden-Baden erholt hatte, mit einem recht guten Gesundheitszustand, sodaß er noch einmal frischen Mut faßte, mit Hilfe einer veränderten Lebensweise seine beiden Pflichten, sein Amt und seine eigenste, höhere Aufgabe mit einander durchzuführen. Es hatte sich erwiesen, daß das Klima von Basel besonders ungeeignet für ihn war; so wollte er sich dort nur ein Absteigequartier nehmen, die Woche über seine Kollegien halten und alle Sonnabende in die so leicht zu erreichende Höhenluft der Schweizer Berge entfliehen. Bis Ende November 1878 hat ihm auch diese Lebensweise recht wohlgetan. Während dieser Zeit ist die erste Schrift dieses Bandes »Vermischte Meinungen und Sprüche« zum größten Teil entstanden, welcher er noch eine Nachlese von Aphorismen hinzufügte, die er den Niederschriften aus Sorrent und Rosenlauibad entnahm. Das Manuskript wurde von der trefflichen Freundin Frau Marie Baumgartner in Lörrach für den Druck abgeschrieben und von meinem Bruder geordnet und nachgeprüft. War es nun wiederum die Übermüdung seiner Augen oder hatte er sich sonst überarbeitet – kurzum, gegen Weihnachten wurde er wieder so von Schmerzen der Augen und des Kopfes gequält, daß er von nun an den festen Entschluss faßte, sich von Basel loszulösen. Eine Osterreise mit Aufenthalt in Genf brachte keine Erleichterung; und im Frühjahr 1879, bei Anfang des Sommersemesters, befiel ihn ein solcher Zustand der Schwäche, daß sein Arzt die höchste Besorgnis hatte und Jedermann glaubte, daß es mit seinem Leben bald zu Ende gehen müßte. Ich war damals in Naumburg bei meiner Mutter und wurde schnell zu ihm gerufen. Wir verließen Basel sogleich, um in der Nähe von Bern, Schloß Bremgarten, einen Höhenluftkurort, aufzusuchen. So elend wie damals habe ich meinen teuern Bruder nie gesehen; er entschloß sich auch, sein Abschiedsgesuch bei der Erziehungsbehörde einzureichen:
»Der Zustand meiner Gesundheit, dessentwegen ich mich schon mehrere Male mit einem Gesuch an Sie wenden mußte, läßt mich heute den letzten Schritt tun und die Bitte aussprechen, aus meiner bisherigen Stellung als Lehrer an der Universität ausscheiden zu dürfen. Die inzwischen immer noch gewachsene äußerste Schmerzhaftigkeit meines Kopfes, die immer größer gewordene Einbuße an Zeit, welche ich durch die zwei- bis sechstägigen Anfälle erleide, die von Neuem (durch Herrn Schieß) festgestellte erhebliche Abnahme meines Sehvermögens, welche mir kaum noch zwanzig Minuten erlaubt ohne Schmerzen zu lesen und zu schreiben – dies Alles zusammen drängt mich einzugestehen, daß ich meinen akademischen Pflichten nicht mehr genügen, ja ihnen überhaupt von nun an nicht mehr nachkommen kann, nachdem ich schon in den letzten Jahren mir manche Unregelmäßigkeit in der Erfüllung dieser Pflichten, jedesmal zu meinem großen Leidwesen, nachsehen mußte. Es würde zum Nachtheile unserer Universität und der philologischen Studien an ihr ausschlagen, wenn ich noch länger eine Stellung bekleiden müßte, der ich jetzt nicht mehr gewachsen bin; auch habe ich keine Aussicht mehr in kürzerer Zeit auf eine Besserung in dem chronisch gewordenen Zustande meines Kopfleidens rechnen zu dürfen, da ich nun seit Jahren Versuche über Versuche zu seiner Beseitigung gemacht und mein Leben auf das Strengste danach geregelt habe, unter Entsagungen jeder Art – umsonst, wie ich mir heute eingestehen muß, wo ich den Glauben nicht mehr habe, meinem Leiden noch lange widerstehen zu können. So bleibt mir nur übrig, unter Hinweis auf § 20 des Universitäts-Gesetzes mit tiefem Bedauern den Wunsch meiner Entlassung auszusprechen, zugleich mit dem Dank für die vielen Beweise wohlwollender Nachsicht, welche die hohe Behörde mir vom Tage meiner Berufung an bis heute gegeben hat.« Die Regierung antwortete sehr herzlich bedauernd, doch ist das Schreiben verloren gegangen, sodaß ich nur einem aus Basel mir zugesandten Entwurf das Folgende entnehmen kann:
»Indem wir Ihnen die Urkunde zustellen, womit der Regierungsrat Ihrem Entlassungsgesuche Folge gibt, sprechen wir unsererseits unsern wärmsten Dank aus für die treue Hingebung, womit Sie an unserer Universität und am Pädagogium gewirkt haben, so lange und so weit Ihnen dies nur immer möglich war. Wir geben auch der Hoffnung Raum, daß das Leiden, das zu unserm großen Bedauern Ihrer äußeren Tätigkeit für einstweilen ein Ziel gesetzt hat, in nicht allzu langer Zeit der stillen Wirkung der Zeit und der Ruhe weichen werde. Möge Ihre Geduld nicht auf eine allzu harte Probe gestellt werden!«
Übrigens erholte sich mein Bruder merkwürdig schnell von diesem Zustand äußerster Hinfälligkeit; nach vier Wochen hatte er sich bereits so weit gekräftigt, daß er sich allein nach dem Engadin begeben konnte, während ich nach Basel ging, um den ganzen Haushalt aufzulösen. Dabei muß ich mich noch jetzt verwundern, welches außerordentliche Vertrauen mir mein Bruder in Hinsicht auf seine Manuskripte damals bewiesen hat. Während des einen Tages, den wir noch zusammen in Basel verbrachten, ehe wir nach dem Luftkurort reisten, gab er mir noch Anweisungen, wie ich mit seiner Bibliothek und seinen Büchern verfahren sollte. Einen Teil seiner Bücher hatte er bereits verschenkt und verkauft, aber die Hauptmasse seiner Bibliothek war noch vorhanden und sollte in Kisten eingepackt bei Freunden eingestellt werden, mit Ausnahme von zwei gefüllten Koffern, die er auf die Reise mitnehmen wollte. Ganz schrecklich war mir, was er über seine Manuskripte bestimmte! Er hatte die Gewohnheit die Vorarbeiten zu seinen Schriften in feste Hefte zu schreiben; von diesen hatte er nun zwei Haufen gemacht, der eine sollte eingepackt, der andere verbrannt werden. »Was soll ich noch mit diesen Heften, ich bin nächstens entweder blind oder tot«, meinte er (während der schlimmen Leidenszeit war die Sehkraft sehr herabgesunken). Diese Bücher mit seiner lieben Handschrift verbrennen zu sollen, war mir ein unfaßbarer Gedanke. »Fritz«, sagte ich zögernd, »wie kann man diese festen Hefte verbrennen?« »Mit den Deckeln geht es natürlich nicht,« sagte er, nahm ein Federmesser und schnitt innen die Bänder durch, die das Heft mit dem Deckel verbanden. Zum Glück hatte er eines der Hefte ergriffen, in welchem Etwas stand von dem er zuvor gesagt hatte, daß es aufbewahrt werden sollte. »Siehst Du, Fritz, da wäre nun gleich etwas Falsches verbrannt worden,« meinte ich, »laß mich das Ganze erst noch einmal aussuchen«. Schließlich überließ er Alles, wie er sagte: »meiner Liebe und Klugheit«. Natürlich habe ich keine Zeile verbrannt, sondern alles von ihm zur Vernichtung Bestimmte sorgfältig eingepackt und nach Naumburg geschickt. Um den Vernichtungseifer meines Bruders zu verstehen, muß man sich vorstellen, wie grenzenlos unangenehm es ihm war, wenn Andere außer mir Einsicht in seine Manuskripte nahmen; selbst Prof. Overbeck, der sich damals zur Durchsicht seiner Papiere anbot, und welchem er sonst großes Vertrauen zeigte, wies er ziemlich schroff zurück. Es wäre ihm lieber gewesen Alles zu verbrennen, als diese Niederschriften in Anderer Hände zu wissen.
Von Schloß Bremgarten ging er zunächst nach