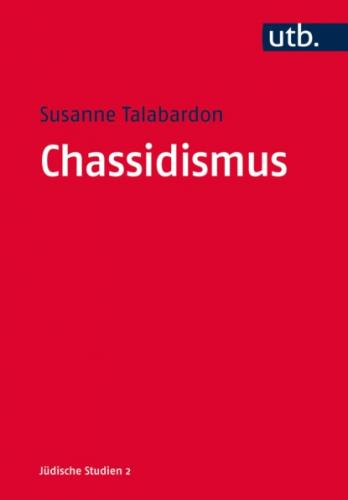Susanne Talabardon
Chassidismus
Mohr Siebeck GmbH & Co. KG
|1|Vorwort
Diese Einführung in ‚den Chassidismus‘ kommt in mancherlei Beziehung viel zu früh. Die moderne Forschung zu jener vielgestaltigen, dynamischen jüdischen Strömung steckt noch in ihren Anfängen. So sind zwar außerordentlich tragfähige und teilweise umfassende historische und religionsgeschichtliche Arbeiten zu den frühen chassidischen Meistern entstanden, zu bemerkenswerten späteren Entwicklungen existieren jedoch allenfalls Einzelstudien. Manche Region, die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts bedeutende chassidische Gruppierungen beheimatete – man denke an das slowakisch-ungarische Grenzgebiet oder Bessarabien – hat bisher kaum systematische Beachtung erfahren. Einen wirklichen Überblick über die höchst verschiedenfarbigen Gemeinschaften und ihre theoretischen Konzepte, inklusive ihrer Entstehungsbedingungen oder der Wechselwirkungen zwischen ihnen, kann derzeit eigentlich niemand wissenschaftlich verantwortlich vermitteln. Das vorliegende Buch kann daher höchstens als deskriptive Momentaufnahme einer baulichen Struktur gelten, deren Konstruktionspläne noch nicht bekannt sind.
Andererseits erscheint es für den deutschen Sprachraum überfällig, eine auf modernen Forschungen basierende Übersicht zur Geschichte des Chassidismus anzubieten. Trotz grundlegender Arbeiten deutscher Judaisten wie Karl Erich Grözinger oder Michael Brocke ist das Bild jener osteuropäischen Reformbewegung in der hiesigen Öffentlichkeit noch weithin geprägt von den romantischen Entwürfen Martin Bubers (1878–1965). In der Tat spielte der Religionsphilosoph eine entscheidende Rolle dabei, den Westen Europas auf den Chassidismus aufmerksam zu machen. Dass Bubers Hörer und Leser es letztlich allerdings mit einer von ihm selbst transformierten und den westlichen Bedürfnissen angepassten Form jüdischer Theosophie und Lebensweise zu tun bekamen, ahn(t)en die meisten nicht.
Auch das zweite, im deutschen Sprachraum weit verbreitete Referenzwerk, die zweibändige „Geschichte des Chassidismus“ von Simon Dubnow, entspricht in vielerlei Hinsicht nicht dem gegenwärtigen Forschungsstand. Das gilt insbesondere für dessen Grundannahme, der Chassidismus sei etwa ab dem Jahre 1815 zu einem „Zaddikismus“, einer blindwütigen, von abergläubischen Vorstellungen gespeisten Verehrung von chassidischen Heiligen degeneriert. Krisen- und Katastrophentheorien, die bis in die achtziger |2|Jahre des 20. Jahrhunderts die Forschungslandschaft prägen sollten, werden heute kaum mehr vertreten. Wer indessen derlei neuere wissenschaftliche Erkenntnisse in deutscher Sprache rezipieren möchte, ist in der Regel an Essays oder Aufsätze gewiesen, die nur Teilaspekte des Gesamtbildes in neuer Perspektive vermitteln können.
Angesichts dieser Diagnose könnte man den Versuch einer umfassenden Darstellung des osteuropäischen Chassidismus (in deutscher Sprache) legitimieren. Es ist womöglich besser, etwas Vorläufiges zur Kenntnis zu nehmen, als sich mit veralteten oder nicht als wissenschaftliche Darstellung gedachten Auskünften zum Thema zufrieden zu geben.
Leider müssen wir diesen ersten Warnhinweisen weitere Einschränkungen folgen lassen. Die vorliegende Einführung hat aus der Vielzahl der Phänomene, Gruppen und Strömungen eine Auswahl treffen müssen, die sich vor allem an der vorfindlichen Forschungslage und der Bedeutung einiger Spielarten des Chassidismus für die Gegenwart orientiert. Manche Regionen, die insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert (vor der Schoa) bedeutende chassidische Dependancen aufzuweisen hatten, wie vor allem Ungarn, die Bukowina und Moldawien, finden sich im Folgenden kaum berücksichtigt. Gleiches gilt für den Chassidismus in Westeuropa nach 1945.
Etliche Probleme bereiteten auch die geographischen Bezeichnungen für Orte und Regionen in Ost- und Mittelosteuropa. Die häufig wechselnden Zugehörigkeiten bestimmter Landschaften zu polnischen, russischen oder österreichischen Herrschaftsräumen, manch kurzes nationalstaatliches Intermezzo, die zumeist multiethnische Besiedlung, die späte Herausbildung von Namen für Territorien und für deren Bewohner (man denke nur an „Ukraine“ oder „Weißrussland“), sorgen für konstante Verwirrung. Je nachdem, ob man eine polnische, russische, hebräische oder jiddische Quelle nachschlägt, differieren die Bezeichnungen für ein und dieselbe Stadt- oder Landgemeinde erheblich. Die Notlösung für die folgende Darstellung besteht darin, in der Regel die polnische Bezeichnung für einen Ort zu verwenden, ungeachtet etwaiger Herrschaftswechsel in späterer Zeit. Für die chassidischen Gruppen und deren Rebbes, die sich nach einer bestimmten (galizianischen, podolischen, wolhynischen) Lokalität benannten, wurde hingegen – so der Name etabliert ist – auf die zumeist dem Jiddischen entlehnte Bezeichnung zurückgegriffen (etwa: Lubawitscher, statt Ljubavicher). In einer Synopse am Schluss des Buches kann man sich über die verschiedenen Namensvarianten in anderen gängigen Sprachen informieren. Die wenigen in deutschem Gebrauch fest verankerten Bezeichnungen (zum Beispiel Warschau, Wilna oder Lemberg) wurden beibehalten.
|3|Noch ein wenig komplexer gestaltete sich die Suche nach praktikablen Benennungen der regionalen Schauplätze des osteuropäischen Chassidismus. Hier hat man in der Regel die Wahl zwischen historischer Korrektheit (Podolien, Wolhynien, Galizien) – wobei kaum jemand diese Landschaften heutzutage noch orten kann – oder Verständlichkeit bei gleichzeitig schwerem Anachronismus (etwa Ukraine oder Weißrussland). Eine wirklich befriedigende Lösung, so muss die Verfasserin eingestehen, wurde nicht gefunden. Der Kompromiss besteht darin, wo immer möglich die historisch korrekten Termini zu verwenden und dem Buch mehrere Landkarten beizufügen. Schwierigkeiten bereitete insbesondere das Territorium zwischen Litauen und dem südlich davon gelegenen Gebiet Podolien. Es ist für die Entwicklung des Chassidismus essentiell, hatte aber im 18. und 19. Jahrhundert keinen allgemein anerkannten Namen. Ich habe es hin und wieder als Weißrussland bezeichnet, wohl wissend, dass es nicht wirklich stimmt.
Vom Chaos bei Personennamen und den vielfältigen Transkriptionstücken will ich gar nicht erst anfangen. Auch hier häufen sich Kompromisse. Die Transkription hebräischer, jiddischer und russischer Begriffe und Bezeichnungen orientiert sich an deutschen Ausspracheregeln und erhebt nicht den Anspruch, eindeutig zu transliterieren.
Für Leser/innen, die mit der jüdischen Tradition noch nicht so vertraut sind, empfiehlt es sich, das zweite Kapitel der Darstellung zunächst zu überspringen. Es enthält eine sehr kurzgefasste Beschreibung der Entwicklung der Begriffe Chassid und Zaddik im Laufe der jüdischen Religionsgeschichte.
Ohne die Hilfe und die Mitwirkung etlicher Freunde und Kollegen wäre das vorliegende Buch vermutlich nichts geworden. Ich danke von ganzem Herzen meinem verehrten akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. Karl Erich Grözinger, für allerlei fachliche Unterstützung und seinen steten moralischen Beistand, Herrn Raphael Pifko für Losch’n-Hilfe und guten Rat und Herrn Dr. Felix Schnell für seine äußerst kundige Unterstützung bei der Navigation durch osteuropäische Geschichte und Geographie. Meine Studierenden in Bamberg waren dazu bereit, sich lesenderweise durch Probekapitel und hörenderweise durch eine Vorlesung über den Chassidismus zu quälen, und halfen mir, klarer zu denken, indem sie meine Ausführungen mitunter als zu kompliziert brandmarkten. Annette Strobler, der eigentliche spiritus rector meiner Professur, half mir beim Korrekturlesen – aus reiner Freundlichkeit. Ihnen allen sei ganz herzlich gedankt!
(Alle verbleibenden Fehler und Unzulänglichlichkeiten sind natürlich von mir selbst zu verantworten.)
|5|1. Warum es so schwierig ist, den osteuropäischen Chassidismus zu beschreiben
Dan, Joseph, A Bow to Frumkian Hasidism, Modern Judaism 11, 1991, S. 175–193.
Davidowicz, Klaus, Gerschom Scholem und Martin Buber. Die Geschichte eines Mißverständnisses, Neukirchen-Vluyn 1995, besonders S. 104–143.
Elior, Rachel, The Mystical Origins of Hasidism, Oxford, Portland 2008, besonders S. 195–205.
Etkes, Immanuel, The Study of Hasidism: