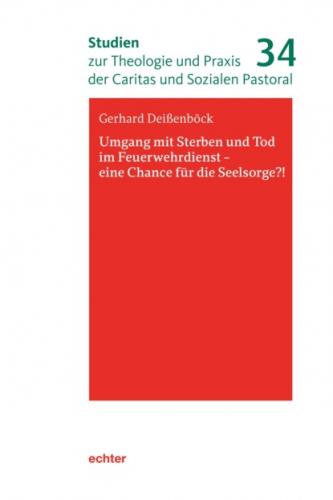34
Studien
zur Theologie und Praxis
der Caritas und Sozialen Pastoral
Herausgegeben von
Klaus Baumann und
Ursula Nothelle-Wildfeuer
Begründet von
Heinrich Pompeÿ und
Lothar Roos
Band 34
Gerhard Deißenböck
Umgang mit Sterben und Tod
im Feuerwehrdienst –
eine Chance für die Seelsorge?!
echter
Als Dissertation eingereicht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Paris-Lodron-Universität Salzburg
Dekan Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Alois Halbmayr
1. Gutachter Pater em. Univ.-Prof. Mag. Dr. Friedrich Schleinzer OCist (Pastoraltheologie)
2. Gutachter em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Wolbert (Moraltheologie)
Tag des Promotionsbeschlusses 28. 11. 2017
Bibliografische Information
der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ›http://dnb.d-nb.de‹ abrufbar.
1. Auflage 2019
© 2019 Echter Verlag GmbH, Würzburg
E-Book-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
ISBN
978-3-429-05386-4
978-3-429-05033-7 (PDF)
978-3-429-06443-3 (ePub)
Geleitwort
Die im Begriff »Caritas« enthaltene Einstellung von Menschen ihrem Nächsten gegenüber – im Sinne von »Nächstenliebe« oder »Fürsorge« – wird vielerorts in den Freiwilligen Feuerwehren ganz konkret gelebt. Gerade in Bayern tun dies besonders viele: Derzeit leisten etwa 320.000 Männer und Frauen aktiven Dienst in bayerischen freiwilligen Feuerwehren, das heißt, 25 von 1000 Bürgern. Es wird hierbei natürlich ein enormes zeitliches Engagement für Ausbildung und Übungen erbracht - dazu gehören aber auch die »echten Einsätze«. Darin genau besteht der Unterschied zu anderen ehrenamtlichen Aktivitäten. Man kann sich auch mit großem Aufwand im sozialen, kirchlichen, kulturellen oder sportlichen Bereich einbringen – die Bereitschaft, Tag und Nacht, egal in welcher persönlichen Lebenslage man sich gerade befindet, dem Ruf des Funkalarmempfängers zu folgen und in einen »Einsatz« zu fahren, von dem man beim Ausrücken noch nicht weiß, was einen erwartet, ist noch einmal etwas ganz anderes.
Auch wenn es viele unproblematische Aufgaben gibt, wie z. B. »Straße reinigen« aufgrund einer Ölspur, sind im Laufe der Zeit, gerade bei größeren Feuerwehren, immer wieder auch Einsätze dabei, bei denen man mit Schwerverletzten oder gar Toten konfrontiert ist.
In den mehr als vier Jahrzehnten meines bisherigen aktiven Dienstes habe ich derartige Situationen oft erlebt: man ist grundsätzlich bereit und gut ausgebildet, das Material ist top. Alarmierung: »VU mit eingeklemmter Person«, Anfahrt ins Gerätehaus, Umziehen, Aufsitzen, Ausrücken. Auf der Anfahrt: Anlegen der »Aidshandschuhe«, Prüfen der Wettersituation, Kontrolle der persönlichen Schutzausrüstung, Ankunft am Einsatzort. Was dann geschieht, welche Entscheidungen fallen, was man konkret erlebt, läuft dann ab wie eine filmische Handlung. Wenn die geretteten Personen erstversorgt, geborgen und im RTW oder im Rettungshubschrauber verschwunden sind, beginnt bei vielen erst wieder die Wahrnehmung der äußeren Umstände: es ist kalt, man ist außer Atem, etc.. Das gerade Erlebte reflektiert man meist erst in einem gewissen zeitlichen Abstand. Oft geschieht das, wenn man nach der Rückkehr von nächtlichen Einsätzen versucht, noch einmal etwas Schlaf zu finden, bevor man morgens wieder zur Arbeit aufstehen muss. Das ist die Zeit der Fragen: hätte man nicht früher ein anderes Gerät einsetzen sollen, wäre es nicht besser gewesen …?
Wenn es Schwerverletzte oder Tote gegeben hat, sind diese Eindrücke besonders bewegend, ganz intensiv, wenn die Verunfallten leiden mussten oder Angehörige unter starker emotionaler Erregung den Einsatz behinderten.
Erlebnisse dieser Art belasten jeden – ganz besonders natürlich die freiwilligen Einsatzkräfte, die nur selten mit solchen Situationen konfrontiert sind. Deshalb ist es wichtig, Menschen, die in ihrem freiwilligen Engagement für ihre Mitmenschen in seelische Belastungssituationen geraten sind, professionelle Hilfe anbieten zu können. Eine Antwort zu finden auf die Fragen: „Warum musste dieser Mensch gerade jetzt an dieser Stelle sterben und warum konnten wir nicht mehr helfen?“, fällt jedem schwer und belastet einen, oft noch lange Zeit.
Die Verankerung im christlichen Glauben bietet hierfür oft den einzigen Ankerpunkt, um in diesen Situationen Trost und Hilfe spenden zu können. Feuerwehrseelsorgerinnen und -seelsorger oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kriseninterventionsteam mit einem gefestigten christlichen Gottes- und Menschenbild haben in solchen Situationen schon oft wertvolle Hilfe geleistet.
Aus diesem Grunde halte ich die Seelsorge für eine wichtige Einrichtung, um die Probleme im Umgang mit Sterben und Tod im täglichen Einsatzgeschehen der freiwilligen Feuerwehren bewältigen zu können.
Dr. Marcel Huber MdL
Staatsminister a D.
Ehemaliger Kommandant FFAmpfing
Vorwort
Der Umgang mit Sterben und Tod im Feuerwehrdienst – warum beschäftigt man sich in dieser Intensität mit den dunklen Seiten des Lebens und das auch noch ausdrücklich im Kontext der Feuerwehr – sind sie doch eigentlich die Helden und großen Retter. Die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit Sterben und Tod im ehrenamtlichen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr sind ein maßgeblicher Antrieb dieses Dissertationsprojektes. Im Rahmen dieses Vorwortes möchte ich die persönliche Motivation noch etwas differenzierter in den Blick nehmen. Die Worte der Einleitung meiner Diplomarbeit „Grenzerfahrung Tod. Idee und Konzept einer Schulung für AusbilderInnen der Bayerischen Jugendfeuerwehren“ aus dem Jahr 2008 drücken auch neun Jahre später immer noch die Beweggründe aus, die im tiefsten Innern hinter dieser Arbeit stehen:
Es war der 3. November des Jahres 1996. Ein typischer Sonntag im Herbst. Um 7.30 [Uhr] begann die Sirene der Freiwilligen Feuerwehr in Heldenstein zu heulen. Unfall mit Schienenfahrzeug, eine Person Exitus, auf der Bahnstrecke Mühldorf a. Inn nach München, in Höhe B12 Ausfahrt Küham, lautete die Meldung der Polizei. Vor diesem Unfall haben sich schon mehrere Personen im Zeitraum eines Monats an dieser Stelle das Leben genommen. So auch zweifelsfrei an diesem Sonntag. Als damaliges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Heldenstein rückte ich mit aus. Als 18-Jähriger und damit frisches Mitglied in der aktiven Mannschaft saß ich im zweiten Fahrzeug. Auf der Anfahrt dachten wir uns – durch die »Routine« dieser Einsätze – nicht mehr viel. Auf einer Brücke über der eigentlichen Unfallstelle blieben wir auf Bereitschaft und machten noch Witze über die verunfallte Person. Zum Schluss des Einsatzes durften wir den Gleiskörper reinigen. Jung und motiviert gingen wir ans Werk. Es machte mir nichts aus, denn wir kannten die Person nicht. Und damit war die notwendige Distanz gegeben. Der Einsatz war schnell abgearbeitet und nach Herstellung der Einsatzbereitschaft gingen wir alle nach Hause zu unseren Familien. Ca. um 10.00 [Uhr] vormittags, ich war gerade nach dem Besuch der heiligen Messe zu Hause angekommen und im Gespräch mit meiner Schwester und meiner Großmutter vertieft, schellte die Glocke an der Haustür. Ich öffnete diese und sah den Beamten der Kriminalpolizei, der auch an der Unfallstelle war, an der Türe