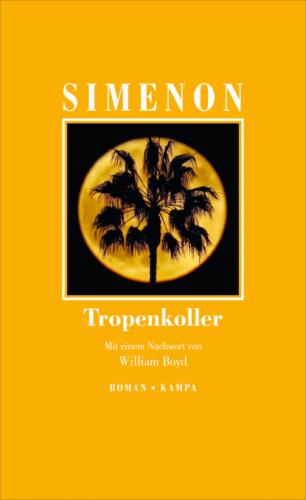Band 4
Georges Simenon
Tropenkoller
Roman
Mit einem Nachwort von William Boyd
Aus dem Französischen von Hansjürgen Wille, Barbara Klau und Ulrike Ostermeyer
Kampa
1
Bestand denn irgendein Grund zur Beunruhigung? Nein. Nichts Ungewöhnliches war geschehen. Er musste sich nicht bedroht fühlen. Es wäre lachhaft, jetzt die Ruhe zu verlieren, das war ihm selbst klar, weshalb er schon jetzt, während der Feier, dagegen anzugehen versuchte.
Im Übrigen war es keine Unruhe im eigentlichen Sinn. Er hätte auch gar nicht sagen können, wann genau ihn die Beklommenheit gepackt hatte, dieses Unbehagen, das durch ein kaum merkliches Ungleichgewicht hervorgerufen wurde.
Jedenfalls nicht in dem Augenblick, da er Europa verließ. Im Gegenteil, Joseph Timar war beherzt und glühend vor Begeisterung aufgebrochen.
Bei der Landung in Libreville, seiner ersten Berührung mit Gabun? Das Schiff hatte auf der Reede geankert, so weit draußen, dass vom Festland nur eine weiße Linie zu sehen war, der Strand, über dem sich der Wald als ein dunkler Streifen hinzog. Große graue Wellen hoben das kleine Boot und ließen es immer wieder gegen den Rumpf des Dampfers stoßen. Timar stand allein unten am Fallreep, das Wasser zu seinen Füßen, und lauerte auf das Boot, das für eine Sekunde nah herankam, ehe es wieder forttrieb.
Ein nackter Arm, der Arm eines Schwarzen, hatte ihn ergriffen, und dann waren er und der Schwarze über die Wellenkämme davongesprungen. Später, vielleicht eine Viertelstunde oder mehr, als vom Dampfer schon die Signale ertönten, legten sie an einer Mole aus übereinandergeworfenen Betonwürfeln an.
Dort war niemand, nicht einmal ein Schwarzer. Niemand erwartete jemanden. Einzig Timar stand dort, inmitten seiner Koffer!
Aber auch in diesem Augenblick hatte ihn die Unruhe nicht gepackt. Er hatte sich zu helfen gewusst. Er hatte einem vorüberfahrenden Lastwagen gewinkt, und der hatte ihn ins Central, das einzige Hotel von Libreville, gebracht.
Und wie schön war das gewesen! So pittoresk. Und typisch afrikanisch! In dem Lokal, dessen Wände mit afrikanischen Masken geschmückt waren, setzte er ein Grammophon mit Schalltrichter in Gang, während der Boy ihm einen Whisky einschenkte, und kam sich vor wie ein Kolonist.
Was den Zwischenfall anging, so war der mehr komisch als dramatisch gewesen. Und so typisch für die Kolonien! Timar war begeistert von allem, was eine koloniale Prägung hatte.
Einem seiner Onkel war es zu verdanken, dass man ihn bei der Sacova engagiert hatte. Der Vertreter der Gesellschaft in Frankreich hatte ihm angekündigt, er würde mitten im Wald leben, irgendwo in der Nähe von Libreville, Holz fällen und den Einheimischen allerlei Krimskrams verkaufen.
Kaum an Land, war Timar in eine kümmerliche Faktorei gestürzt, über der das Wort Sacova prangte. Mit ausgestreckter Hand war er auf einen Mann mit melancholischer oder angewiderter Miene zugegangen, der diese Hand angesehen, aber nicht ergriffen hatte.
»Sind Sie der Direktor? … Sehr erfreut. Ich bin der neue Angestellte.«
»Angestellt von wem, wofür? Was wollen Sie hier tun? Ich brauche keinen Angestellten!«
Timar war nicht zurückgezuckt. Das hatte den Direktor erstaunt. Mit seinen durch die Brillengläser riesig wirkenden Augen hatte er ihn forschend angeblickt und war fast höflich, ja, im Ton sogar geradezu vertraulich geworden.
»Immer wieder die alte Geschichte! Die Büros in Frankreich, die sich in die Leitung der kolonialen Angelegenheiten einmischen!« Man hatte Timar den Posten versprochen? Nun, dorthin dauerte es zehn Tage mit der Pinasse, ganz den Fluss hinauf. Aber erstens war die Pinasse leck und würde erst in einem Monat wieder fahrbereit sein. Zweitens besetzte ein verrückter Alter den Posten und wollte jeden erschießen, der käme, um ihn abzulösen.
»Sehen Sie zu, wie Sie zurechtkommen. Ich habe damit nichts zu tun.«
Vier Tage waren seitdem vergangen, vier Tage war Joseph Timar jetzt in Afrika. Er kannte Libreville schon besser als La Rochelle, wo er geboren war: ein langer, von Kokospalmen gesäumter Quai aus rotem Schotter, der an dem unter freiem Himmel liegenden Markt der Einheimischen entlangführte, alle hundert Meter gab es eine Faktorei, und abseits davon standen einige Villen, im Grün versteckt.
Er hatte sich die beschädigte Pinasse angesehen. Niemand arbeitete daran. Niemand hatte jemanden dazu beauftragt. Er wagte es nicht, selbst den Auftrag zu erteilen, er, Timar, der Neuankömmling, der in gewisser Weise überzählig war.
Er war dreiundzwanzig Jahre alt. Über seine Wohlerzogenheit und guten Manieren lachten selbst die Boys, die ihn bei Tisch bedienten.
Kein Grund zur Beunruhigung? O doch! Er kannte den Grund, und wenn er in Gedanken all die falschen Gründe aufzählte, dann nur, um den Augenblick hinauszuzögern, da er bei dem wahren Grund anlangte.
Der Grund war da, diffus verstreut um ihn herum und im Hotel. Er war das Hotel selbst. Er war …
Er war hingerissen gewesen vom äußeren Anblick des Central. Ein gelbes Gebäude, etwa fünfzig Meter hinter den Kokospalmen landeinwärts, inmitten eines Gewirrs merkwürdiger Pflanzen.
Der große Raum, zugleich Café und Restaurant, hatte sehr helle Wände, deren Pastellfarben an die Provence erinnerten, und eine Bar aus lackiertem Mahagoni mit Messingbeschlägen und hohen Hockern davor, die den Eindruck von Behaglichkeit vermittelten.
Hier nahmen die Junggesellen von Libreville ihre Mahlzeiten ein. Jeder hatte seinen Tisch und seinen Serviettenring.
Die Zimmer im oberen Stockwerk waren nie belegt. Kahle und leere Zimmer, ebenfalls mit pastellfarbenen Wänden. Betten, über denen Moskitonetze hingen, und hier und dort ein alter Krug, eine angestoßene Waschschüssel, ein leerer Überseekoffer.
Überall, oben wie unten, wurden einfallende Sonnenstrahlen von den Jalousien vor den Fenstern zerschnitten, sodass sich durch das ganze Haus Gittermuster aus Licht und Schatten zogen.
Timars Gepäck war das eines jungen Mannes aus guter Familie, und es wirkte komisch, wie es da in seinem Zimmer auf dem Boden stand. Er war es nicht gewohnt, sich in einer kleinen Schüssel zu waschen, und schon gar nicht, sich für gewisse Verrichtungen ins Gebüsch zu schlagen.
Auch all die herumschwirrenden Insekten, unbekannten Fliegen, fliegenden Skorpione, pelzigen Spinnen kannte er nicht.
Und dann wurde er zum ersten Mal von dem heimtückischen Unbehagen befallen, das ihn hartnäckig wie ein Schwarm Insekten verfolgen sollte. Als er am ersten Abend seine Kerze gelöscht hatte, erkannte er trotz der Dunkelheit noch den bleichen Käfig des Moskitonetzes. Über dem Tüll spürte er eine gewaltige Leere, in der es kaum wahrnehmbar knisterte, und winzige Lebewesen – Skorpion? Mücke? Spinne? –, die sich manchmal auf das durchsichtige Gewebe setzten.
Und in diesem weichen Käfig lag er und versuchte, den leisen Geräuschen zu folgen, dem Erzittern der Luft und den unvermutet eintretenden Momenten völliger Stille.
Abrupt hatte er sich auf die Ellbogen gestützt. Es war schon am Morgen. Die Sonnenstrahlen sickerten herein, und die Tür hatte sich soeben geöffnet. Die Wirtin des Hotels sah ihn an, ruhig lächelnd.
Timar war nackt. Das wurde ihm jäh bewusst. Seine Schultern und sein Oberkörper tauchten blass und feucht aus den zerwühlten Laken auf. Warum war er nackt? Angestrengt versuchte er, sich zu erinnern.
Ihm war heiß gewesen. Er hatte stark geschwitzt. Vergeblich hatte er nach Streichhölzern gesucht, denn ihm schien, dass nicht fassbare Tierchen über seine Haut krabbelten.
Und da, vermutlich mitten in der Nacht, hatte er seinen Pyjama ausgezogen. Sodass nun die Wirtin seine blasse Haut und die hervorspringenden Rippen sehen konnte. Sie schloss die Tür mit verblüffender Ruhe und fragte:
»Haben