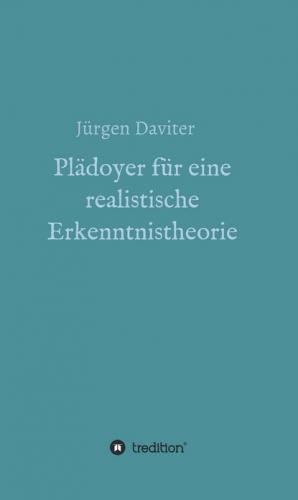Jürgen Daviter
Plädoyer für eine realistischeErkenntnistheorie
© Jürgen Daviter 2020
Verlag & Druck: tredition GmbH‚ Halenreie 40-44‚
22359 Hamburg
ISBN:
978-3-347-10327-6 (Paperback)
978-3-347-10328-3 (Hardcover)
978-3-347-10329-0 (e-Book)
Das Werk‚ einschließlich seiner Teile‚ ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung‚ Übersetzung‚ Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Hans Albert gewidmet‚
dem unermüdlichen Aufklärer.
Wie können wir umhin‚ uns um die Wahrheit zu bemühen? Wir können es nicht.
Harry G. Frankfurt
Habe Mut‚ dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist der Wahlspruch der Aufklärung.
Immanuel Kant
Vorwort
Dies ist die Leitfrage des Buches: Was bleibt an Erkenntnismöglichkeiten übrig‚ wenn wir einige der wichtigsten Erkenntnistheorien der Neuzeit auf den Prüfstand stellen?
In der langen Tradition der Erkenntnistheorie waren die meisten Philosophen davon überzeugt‚ den Anspruch auf sichere Wahrheitserkenntnis gut begründen zu können. Wen heute die Frage umtreibt‚ ob das überhaupt möglich ist‚ der muss also nach Schwachstellen der Begründung suchen. Das hatte Konsequenzen für die Gestaltung des Buches. Geboten war nüchterne Analyse aus kritischer Distanz.
Ich habe also nicht einfach eigene Überzeugungen‚ wie dieser oder jener philosophische Text zu verstehen sein sollte‚ umstandslos vorgetragen und durch möglichst viel Sekundärliteratur gestützt. Vielmehr habe ich mich mit den jeweiligen philosophischen Originalschriften stark textbezogen auseinandergesetzt. Jeder Philosoph‚ der uns sagen will‚ was und warum wir etwas für wahr halten sollen‚ muss sich gefallen lassen‚ dass er beim Wort genommen wird und seine Argumente möglichst genau geprüft werden. Der Leser soll diese Form der Auseinandersetzung mit den Texten gut nachvollziehen und meine vorgetragenen Argumente selbst beurteilen können. Darum habe ich häufiger als üblich zitiert. Es liegt in der Natur einer kritischen Auseinandersetzung‚ dass die Zitate sich im Wesentlichen auf jene Aspekte beziehen‚ die kritisch erörtert werden sollten.
Eine solche spezielle Beschäftigung mit der Philosophie gerät leicht zu einem nicht ganz ausgewogenen Geschäft: Schönheit und Tiefe der Gedanken kommen dabei zu kurz. Aber wer sich vor falschen Gewissheiten hüten will‚ für den sollte das ein hinnehmbares Opfer sein‚ zumal Schönheit und Tiefe philosophischer Gedanken ohnehin leicht dazu verführen‚ das eigene Denken aufzugeben. Und wenn am Ende Gewissheiten als Illusionen auf der Strecke bleiben‚ steht diesem Verlust ein unschätzbarer Gewinn gegenüber: Wer Wahrheit für grundsätzlich nicht sicher erkennbar hält‚ ist besser gewappnet gegen Dogmen aller Art‚ nicht nur die der anderen‚ sondern auch eigene. Es wird sich zeigen‚ dass man trotzdem nicht einem ratlosen Skeptizismus zum Opfer fallen muss.
Das Plädoyer für eine realistische Erkenntnistheorie hat einen doppelten Sinn: unseren Erkenntnisanspruch auf das zu beschränken‚ was an unserer Welt wenigstens im Prinzip real erfahrbar ist‚ und die Erfolge unseres Strebens nach Wahrheit auch auf diesem Feld realistisch einzuschätzen.
Zum Schluss möchte ich meiner Frau und zwei Freunden ganz herzlich danken. Sybille hat mir über Jahre hinweg mit steter Geduld technische Computerprobleme beseitigt‚ ganz am Ende sogar mit ihrer großen Erfahrung dem alten Computer noch einmal den Geist wieder eingehaucht‚ den er zur Unzeit aufgegeben hatte. Uwe Schipper hat - mit zu feiner Zurückhaltung - hier und da meine Sprache geglättet und mit bewundernswerter Ausdauer das Manuskript korrekturgelesen und mir so geholfen‚ eine ganze Reihe von Fehlern zu vermeiden. Wolfgang Hegels hat einige Kapitel kritisch kommentiert und mir viele hilfreiche Änderungsvorschläge gemacht. Was aber noch viel wichtiger war: Er hat mir jahrelang immer wieder den Gedanken an eine Veröffentlichung nahegelegt. Wer weiß: Vielleicht wäre ohne ihn aus meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Erkenntnistheorie nie ein Buch geworden.
Inhaltsübersicht
I. Einleitung: Zur Klärung einiger wichtiger Begriffe
II. Descartes’ Erkenntnistheorie: Der Beginn der Moderne
III. Humes Erkenntnistheorie: Die Entzauberung kausaler Gewissheiten
IV. Kants Erkenntnistheorie: Der Versuch‚ Humes Skeptizismus zu überwinden
V. Hegels Weltdeutung: Ein Rückfall in die traditionelle Metaphysik
VI. Gadamers Hermeneutik: Verstehen als Wahrheitssuche
VII. Habermas‘ Konsenstheorie der Wahrheit: Die Überforderung des Diskurses
VIII. Poppers Kritischer Rationalismus: Nach allem Scheitern der Letztbegründung
IX. Evolutionäre Erkenntnistheorie: Erkenntnisvermögen naturwissenschaftlich betrachtet
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung:Zur Klärung einiger wichtiger Begriffe
1. Zum Verständnis von Begriffen und Definitionen an sich
2. Erkenntnis und die philosophische Position des Realismus
3. Begriff der Wahrheit
4. Wahrheit‚ Gewissheit und Sicherheit der Erkenntnis
5. Realität‚ Objektsprache und Metasprache
II. Descartes’ Erkenntnistheorie: Der Beginn der Moderne
1. Kurzer Abriss der Erkenntnistheorie nach der Abhandlung
2. Vertiefung der Erkenntnistheorie nach den Meditationen
3. Kritische Würdigung
(1) Das Fehlen eines gültigen Wahrheitskriteriums
(2) Die besondere Beweisnot in Bezug auf die Existenz Gottes
(3) Die Sonderstellung des cogito‚ ergo sum
(4) Abschließende Bemerkungen
III. Humes Erkenntnistheorie: Die Entzauberung kausaler Gewissheiten
1. Vorbemerkung zu den Originalquellen
2. Der radikale Bruch mit der „alten“ Metaphysik
3. Unsere „lebhaften Perzeptionen“ als Grundlage der Ideen
4. Zweifel an der Erkennbarkeit der Kausalität: Der Kern von Humes Erkenntnistheorie
5. Skeptische Lösung dieser Zweifel
6. Zusammenfassung und kritische Schlussbemerkungen
(1) Zur Nichterkennbarkeit der Kausalität
(2) Zu Humes Anerkennung der Kausalität und merkwürdigen Anzweiflungen
(3) Zu einer Präzisierung Humescher Kausalvorstellungen
(4) Humes Ideen zur empirischen Forschung
IV. Kants Erkenntnistheorie: